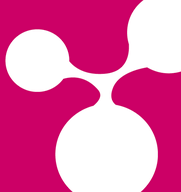GeNeMe 2025
Communities in New Media
17 - 19 September 2025 in Dresden, Germany
Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview |
| Session | ||
Digital Participation
| ||
| Presentations | ||
ID: 1138
/ DigIn: 1
Research Paper Topics: Track - Digital Education Keywords: Social Virtual Reality, Interaktionsqualität in digitalen Konferenzen Ist Social Virtual Reality eine geeignete Alternative für wissenschaftliche Konferenzen? Empirische Einblicke aus einer Pilotstudie 1AKAD University, IDEA; 2Dresden University of Technology, Center for Open Digital Innovation and Participation (CODIP) <p>In den heutigen Zeiten, die von der globalen Klimaerwärmung, schwindenden natürlichen Ressourcen und zunehmend bedrohter Biodiversität geprägt sind, ist ökologisches Handeln in allen Bereichen unserer Gesellschaft essenziell – auch in der Wissenschaft. Beispielsweise kann bei der Durchführung von akademischen Konferenzen ein signifikanter Umfang an Ressourcen, insbesondere für teils weite Anreisen mit Kraftfahrzeugen und Ressourcen, eingespart werden, indem diese online stattfinden (Welch et al., 2010). Der hierfür bislang etablierte Einsatz von Videokonferenzsystemen bringt jedoch diverse Einschränkungen, wie z. B. sehr eingeschränkte Interaktionsmöglichkeiten (Bonfert et al., 2022) und resultierende „Zoom-Müdigkeit“ (Fauville et al., 2023), mit sich, weswegen sogenannte Social-Virtual-Reality (VR)-Umgebungen hierfür zunehmend als Alternative erprobt werden. Bisherige Pilotstudien dazu zeigen eine tendenziell hohe Akzeptanz, Erlebnisqualität und Zufriedenheit mit solchen Formaten (z. B. Ahn et al., 2021; Dyrna et al., 2023; Kirchner & Nordin Forsberg, 2021; Zender & Mulders, 2022), nehmen jedoch nur wenig Bezug auf ihre Vor- und Nachteile gegenüber Durchführungen per Videokonferenz oder in Präsenz sowie auf spezifische Kriterien der Interaktionsqualität, die für den Erfolg solcher Veranstaltungen von maßgeblicher Bedeutung sein dürften. Um dem zu begegnen, wurde eine weitere Pilotstudie durchgeführt, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (<em>N</em> = 34) an einer zweitägigen Fachkonferenz in Social VR teilnahmen und dazu anschließend einen standardisierten Fragebogen beantworteten Er setzte sich aus gebundenen Fragen mit validierten (z. B. Task-Technologie-Fit-Scale; Howard & Rose, 2019) und eigenkonstruierten Skalen, u. a. zur individuellen Formatpräferenz sowie wahrgenommenen Interaktionsmöglichkeiten und -potentialen, und einer offenen Frage zu Vor- und Nachteilen des Formats zusammen. Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt hohe Teilnahmefreude und wahrgenommene Eignung des Veranstaltungsformats. Folglich würden im Falle einer Wahl fast so viele Teilnehmende eine Social-VR-Variante (38 %) präferieren wie eine Präsenzveranstaltung (47 %), während Videokonferenzsystem deutlich weniger Fürsprache (15 %) finden. Gründe hierfür liegen neben der grundlegenden Zeitersparnis, Ortsunabhängigkeit und Barriere-Reduktion durch Online-Formate vor allem im stärkeren räumlich-sozialen Erleben und einem hohen Wohlbefinden bei Teilnahme und Interaktion. Es wird jedoch auch deutlich, dass die Interaktionsqualität dabei, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten zum informellen sozialen Austausch zwischen den Teilnehmenden, u. a. durch die begrenzten Möglichkeiten für die individuelle Kommunikationsgestaltung und non-verbale Signale gegenüber Präsenzveranstaltungen zurücksteht. Hier sollten Forschung und Praxis gemeinsam anknüpfen, um sowohl bestehende Social-VR-Werkzeuge als auch Veranstaltungskonzepte hierfür empirisch begleitet zu optimieren.</p> ID: 1158
/ DigIn: 2
Project Paper (Work in Progress) Topics: Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Keywords: Community-Konzept, Mixed-Method, Online-Plattform, Bildungsplattform, Ko-Konstruktion von Wissen, Community of Practice, Lehrpersonen, Bildungsadministration, Schulnetzwerke, iterative Entwicklung Partizipative Entwicklung einer kollaborativen bundeslandübergreifenden Bildungsplattform für Lehrer:innen: Erste Ergebnisse des Community-Konzepts 1Technische Universität Dresden, Deutschland; 2Universität Leipzig; 3Pädagogische Hochschule Karlsruhe <p>In der zweiten Phase der Bund-Länder Initiative „LemaS-Transfer in die Schullandschaft“ entsteht eine Online-Plattform zur bundeslandübergreifenden Vermittlung der LemaS-P³rodukte (BMBF, 2021), die Strategien, Konzepte, Maßnahmen und Materialien zur Förderung (potenziell) leistungsstarker Schüler:innen umfassen (LemaS Glossar, 2025). Für den praktischen Einsatz durch Lehrpersonen ist eine aktive Auseinandersetzung damit notwendig (Hascher, 2014). Der Beitrag fokussiert die iterative Entwicklung (vgl. Design-Based-Research (DBR) Ansatz; Reinmann, 2017) eines dafür geeigneten Community-Konzepts unter Partizipation verschiedener User-Gruppen (Schulentwicklung in Netzwerken vgl. Marx/Pant, 2022). Es wird aufgezeigt wie der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Technologien in Bildungs-Communities im Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis erfolgen kann. Die Entwicklung der LemaS-Plattform und des Community-Konzeptes basiert auf einem mehrstufigen Mixed-Method-Vorgehen, unter Einbezug agiler Arbeitsmethoden. In explorativen Kleingruppengesprächen wurden erste Bedarfe erfasst und in User-Stories formuliert (Wirdemann ,2022). Darauf aufbauend und in Rückbezug auf theoretische Annahmen zur online Wissensvermittlung (Roos, 2022) sowie Austauschformaten (u.a. Multiplikatorenmodell vgl. Behr et al., 2020; CoP vgl. Kreutzmann, 2022) wurde ein Wireframe entwickelt, der eine Kurslogik zur Vermittlung der LemaS-P³rodukte mit ergänzender Community im Social Media Design abbildete. Angelehnt an den DBR Ansatz, wurde der Wireframe in einer ersten Iterationsschleife in Bezug auf die User Experience und Usability getestet (UEQ, Schrepp, 2023; SUS, Brook, 1996). Die qualitative Erhebung erfolgte durch Fokusgruppengespräche in Workshops, bei denen das Wireframe Lehrpersonen (z.T. Multiplikationsfunktion, Behr et al. 2020), Schulleitungen, Vertretende der Bildungsadministration und technischem Personal sowie Wissenschaftler:innen des Projektes gezeigt wurde. Die Diskurse wurden durch teilnehmende Beobachtung dokumentiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass es einen starken Bedarf an kollaborativen Arbeitsräumen und Austauschformaten zur Unterstützung der Professionalisierung gibt, im Sinne der Ko-Konstruktion von Wissen (Grosche et al., 2020; Klein et al., 2024, Gräsel et al., 2006). Soziale Community-Funktionen spielen hingegen eine untergeordnete Rolle. Als besonders herausfordernd gilt der Anspruch die Plattform mit Community in die föderalen Strukturen zu integrieren, bezugnehmend auf die unterschiedlichen Bildungssysteme, technischen Infrastrukturen und administrative Auffassungen. Ebenso wie die an der Initiative beteiligten 18 Hochschulen und über 800 Schulen aus allen 16 Bundesländern. Der Beitrag zeigt die Entwicklung des Community-Konzepts anhand erster Ergebnisse des iterativen Designprozesses und diskutiert mögliche Implikationen zur Gestaltung von Community-Räumen für bundesweite Online-Angebote im Bildungsbereich.</p> ID: 1148
/ DigIn: 3
Research Paper Topics: Track - Digital Education Keywords: Fernlehre, flipped classroom, digitale Tools, menschenzentrierte Interaktion, education Förderung sozialer Interaktion an Fernhochschulen mit Hilfe digitaler Tools Hamburger Fern-Hochschule, Deutschland <p>Einleitung: Die deutsche Hochschullandschaft hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, neben klassischen Präsenzstudiengängen gewinnen digitale Formate zunehmend an Bedeutung. Inzwischen haben sich verschiedene Formen der online und hybriden Lehre entwickelt. Durch diese kann auf die Diversität der Studierendenschaft und deren Bedürfnis nach Zeit- und Ortsunabhängigkeit beim Studieren besser eingegangen werden. Hierbei hat sich das Modell des Fernstudiums etabliert, welches Präsenzangebote mit online und hybriden Tools kombiniert. In Deutschland gab es im Wintersemester 2023/24 über 250 000 Fernstudierende (Hübsch, 2024). Aus der dargestellten Ausgangslage ergibt sich die Forschungsfrage „Wie kann in verschiedenen Lernsettings an Fernhochschulen durch digitale Tools menschenzentrierte Interaktion ermöglicht werden?“</p> <p>Methodik: Bei einer im Jahr 2024 durchgeführten Online-Umfrage von über 800 Studierenden an einer deutschen Fernhochschule wurden zunächst die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden erfragt, insbesondere hinsichtlich der Integration von Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Chatbots in die Lehre. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Förderung der Vernetzung von Studierenden mit Hilfe verschiedener digitaler Tools. Für die Befragung wurden zunächst wissenschaftliche Arbeiten zur Online-Lehre analysiert, auf deren Basis der verwendete Fragebogen entwickelt wurde. Die Auswertung erfolgte mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.</p> <p>Die Ergebnisse zeigen ein differenziertes Bild: Circa 90 Prozent der Studierenden wünschen sich Flexibilität und Selbstbestimmung beim Studieren, jedoch kritisieren viele Studierende gleichzeitig das Fehlen sozialer Interaktionen. Zudem äußerten einige Teilnehmende den Wunsch nach innovativen Formaten, wie VR, AR und den Einsatz von Chatbots, um die Lernumgebung interaktiver zu gestalten. Mit Hilfe der gewonnen Ergebnisse wurde das flipped-classroom Modell von Sein-Echaluce et al weiterentwickelt – siehe Abbildung 1. Welches darauf abzielt, die soziale Interaktion an Fernhochschulen zu fördern.</p> <p>Diskussion: Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen weitgehend aktuelle Trends und zeigen auch neue Impulse für die Weiterentwicklung digitaler Lernangebote auf. Die Einbindung von VR-Technologien und KI-gestützten Tools wird zukünftig verstärkt eine Rolle in der Lehre spielen, was sich unproblematisch in das entwickelte Modell integrieren lässt. Kritisch ist zu betrachten, dass die Ergebnisse der Studie auf der Erhebung an nur einer Institution beruhen, was die Übertragbarkeit begrenzt.</p> ID: 1115
/ DigIn: 4
Research Paper Topics: Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Keywords: virtual communities, online community platform, online learning, networking, nuclear power sector Identifying Key Features and User Experience Criteria for an Online Social Learning Community Platform in the Nuclear Power Sector 1Technische Universität Dresden, Center of Interdisciplinary Digital Sciences; 2Technische Universität Dresden, Chair of Educational Technology; 3Technische Universität Dresden, Chair of Media Education; 4actimondo eG <p>The current decommissioning of nuclear power plants in Germany is a complex and long-term process that requires specialist staff. However, appropriate programs to qualify such personnel have declined massively since the nuclear phaseout in 2023, plus a substantial number of employees will retire in the next few years (Kettler et al., 2025). To nevertheless keep training decommissioning experts, we consider developing and establishing a domain-specific community platform a promising approach where future staff can acquire competencies through web-based formats and by connecting and collaborating with peers and, in particular, experts. A community platform refers to a social learning platform for a (learning) community of practice (e.g., Pyrko et al., 2019) that integrates features for news, communication, and collaboration with (references to) educational programs and resources as well as directories of institutions, experts, or projects. However, few such complex platforms (e.g., LinkedIn Learning) exist, and sound domain-specific design principles are missing, in particular for the nuclear power sector. In this regard, established models like the Technology Acceptance Model (TAM; Davis, 1989; Venkatesh & Bala, 2008) suggest that users are likely to accept and use emerging technologies when considering them highly useful and easy to use. Consequently, we aim to investigate how a community platform (for the nuclear power sector) can be designed to maximize perceived usefulness, user experience, and, consequently, user acceptance. to tackle this issue and ensure user-centered design, we carried out two studies. Addressing user-friendliness prerequisites, we first performed qualitative shadowing (McDonald, 2005) by observing user experience experts and novices (<em>N</em> = 5) participating in task-based user trials with a comparable platform and subsequently conducting in-depth interviews. Findings, in particular, show that the seamless integration of the platform areas, an intuitive search function, and the free accessibility of all basic functions contribute to high ease of use. To explore usefulness requirements, we conducted a standardized survey, including questions from the TAM questionnaire (Davis, 1989) and opened-ended questions, to assess future users’ perceived usefulness and use intention of potential platform features. In short, preliminary results of the currently still ongoing survey indicate that potential users (<em>N</em> = 35), including nuclear power scientists, project engineers, and managers, find rather conventional educational resources like specialist publications, learning materials, and directories of training courses, particularly useful while being more reserved towards social features like a personalized feed, an event management system, or a messaging service. Results provide fruitful design recommendations for the planned nuclear power community platform and indicative guidelines for designing and optimizing comparable platforms.</p> | ||