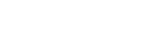Orte der Gemeinschaft gestalten - Interventionen in Schwentinental, Duisburg und Würzburg
Franziska Stelzer, Michaela Roelfes
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, Deutschland
Primär als Orte des kommerziellen Konsums gestaltet, kann insbesondere die klassische Einkaufsstadt den neuen Anforderungen an den öffentlichen Raum im Stadtzentrum heute kaum noch gerecht werden (Volgmann 2022). Die filialisierten, zentralen Einkaufsstraßen können der Konkurrenz durch Online-Handel und großen Einkaufszentren am Rande der Stadt nichts entgegensetzen, es kommt zu trading down- und Verödungseffekten (Heinrich Böll Stiftung 2022). Kommunen stehen dabei vor der Herausforderung aus der Vielzahl von vorgeschlagenen Visionen und Strategien für die urbane Zukunftsfähigkeit diejenigen Ziele, Instrumente und Maßnahmen auszuwählen, die zu den spezifischen, lokalen Herausforderungen passen. Dabei ist auch von großer Bedeutung, die Einwohner*innen der Städte und Gemeinden an diesem transformativen Prozess zu beteiligen (Rückert-John et al. 2021).
An dieser Stelle setzt das durch das UBA geförderte Vorhaben „Städte als Orte nachhaltigen Konsums“ (SONa) an: Es erprobt die Rolle nachhaltiger Konsumangebote in der Transformation der Innenstädte in drei lokalen Interventionen in Duisburg, Schwentinental und Würzburg mit Praxispartner*innen aus engagierter Zivilgesellschaft, Wirtschaftsförderung und Kommunen. Die Realexperimente umfassen dabei die Themen nachhaltiger Bekleidungskonsum, Lieferservice von Leihprodukten und nachhaltige Geschäftsmodelle.
Den wissenschaftlichen Bezugsrahmen bildet das Konzept der transformativen Forschung (Schneidewind & Singer-Brodowski 2013). Diese orientiert sich an konkreten gesellschaftlichen Problemen und ist gekennzeichnet durch einen expliziten Interventionsanspruch. Ziel ist es, konkrete Veränderungsprozesse zu katalysieren und dabei Stakeholder aktiv in den Forschungsprozess mit einzubeziehen. Für die Erfassung der Wirkungen wird der Ansatz von Wiefek, Nagy & Schäfer (2024) verwendet. Der Beitrag fasst die Realexperimente zusammen und stellt das Wirkungsmodell für die Intervention in Schwentinental dar.
Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Öffentlichkeitsbeteiligung: Ein Modell zur Verbesserung der Partizipation in kommunalen Transformationsprojekten
Loba Sagnol, Ian Brow, Johannes Penka
Hochschule Karlsruhe, Deutschland
Bürger:innen als aktive Gestalter in kommunale Transformations- und Innovationsvorhaben einzubinden ist das Ziel des Forschungsprojekts PART-COM. Vor diesem Hintergrund wurden national und international Interviews mit Expert:innen aus Verwaltungen, Ingenieurbüros, NGO’s, Moderationsagenturen und Forschungseinrichtungen geführt. Basierend auf diesen Interviews konnten unterschiedliche Erfolgsfaktoren für eine gelungene Partizipation identifiziert, sowie sich wechselseitig beeinflussende Konfliktfelder abgeleitet werden.
- Mangelhafte Repräsentativität der Bürger:innen
- Fehlender Wille zur Öffentlichkeitsbeteiligung seitens Verwaltung und Politik
- Hohe Hürden für Bürger:innen in diversen Formen (zeitlich, örtlich etc.)
- Mangelhafte Kommunikation zwischen Stadt/Kommune und Bürger:innen
- Fehlende Transparenz seitens der Stadt/Kommune
- Mangel an Wissen seitens der Bürger:innen in diverser Form (technisch, organisatorisch, etc.)
Bleiben diese Konfliktfelder unbeachtet, können sie zu einer Entfremdung zwischen der Stadt/Kommune und deren Bürger:innen führen. Im schlimmsten Fall resultiert das in einer Scheinpartizipation, was eine Gleichgültigkeit seitens aller Beteiligten hervorruft und letztendlich zu einer gefährlichen Demokratieverdrossenheit führen kann.
Diese Konfliktfelder und deren Folgen wurden in einer Negativitätsspirale zusammengefasst und mögliche Ausbruchsszenarien bzw. Lösungsansätze erarbeitet. Das hierdurch entstandene Modell fungiert als Handlungsempfehlung für die Verantwortlichen der Öffentlichkeitsbeteiligung. Damit kann die Praxis der Partizipation stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden. Entsprechend werden den Verwaltungen und anderen in diesem Bereich tätigen Stakeholdern Tools an die Hand gegeben, um ihre Beteiligung gemäß den individuell und übergeordnet existierenden Konfliktfelder zu verbessern.
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts leisten somit einen wichtigen Beitrag, um eine verbesserte Partizipation in Deutschland zu fördern.
Die Gleichzeitigkeit von Räumen der partizipativen Forschung und der Partizipation selbst: Einblicke aus Fokusgruppen im Graefekiez.
Anke Klaever1, Viktoria Scheidler2
1RIFS Potsdam, Deutschland; 2WZB Berlin, Deutschland
Mit einem Wandel von regulatorisch organisierten Planungsansätzen hin zu einem gesellschaftszentrierten Planungsansatz wird die lokale Verkehrswende zunehmend unter Einbeziehung der Bürger*innen gestaltet. Ein Beispiel dafür sind Realexperimente zur Straßenraumumgestaltung. In Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren werden Flächen des motorisierten Verkehrs hin zu Flächen für aktive Mobilität, Freizeit und urbanes Grün umgestaltet.
Diese transdisziplinären und partizipativen Planungsansätze stehen jedoch auch in der Kritik. So werden die partizipativen Prozesse neben der physischen Umgestaltung selbst zum Konfliktgegenstand. Es zeigt sich, dass die von den Initator*innen dieser Realexperimente geförderten Partizipationsformate eher exklusive Räum schaffen, die von einer lauten, privilegierten Minderheit dominiert werden und einen wirklich gemeinsam gestalteten Planungsprozess erschweren. Daher untersucht dieser Beitrag die Gründe der (Nicht)Beteiligung von bisher eher wenig beachteten Stimmen in Straßenumgestaltungen mittels Fokusgruppen. Als Fallbeispiel dient ein Realexperiment in Berlin, bei dem für ein halbes Jahr zwei Straßen umgestaltet wurden. Die Gründe der (Nicht)Beteiligung sind vielschichtig. So scheinen insbesondere das Vertrauen in politische Akteure und Entscheidungsprozesse, sowie individuelle Faktoren und organisatorische Aspekte der Formate ausschlaggebend zu sein. Gleichzeitig hat sich die Fokusgruppe selbst nicht nur als Forschungsinstrument, sondern auch als ein Diskursraum erwiesen, in dem sich Menschen gehört fühlen. Entsprechend haben die Teilnehmer*innen der Fokusgruppen, wenn auch nicht explizit, den transdisziplinären und partizipativen Forschungs- und Planungsprozess geprägt. Basierend auf dieser methodologischen Beobachtung arbeiten wir die Wirkung partizipativer und transdisziplinärer Forschung heraus. Hiermit gehen wir gleichzeitig auf neue Rollen, Potentiale, Konflikte und Privilegien ein, die Forschungsformaten (sowie den Forschenden und den zivilgesellschaftlichen Akteuren selbst) in transdisziplinären Projekten und Akteurskonstellationen begegnen.
COMPAIR - Mit Bürger:innenwissenschaften die städtische Luftqualität verbessern
Aouefa Amoussouvi1, Gesine Wilbrandt2
1European Citizen Science Association (ECSA), Deutschland; 2inter 3 GmbH, Deutschland
COMPAIR ist ein europäisches Projekt, das von 2021 bis 2024 in Athen, Berlin, Flandern, Plowdiw und Sofia durchgeführt wurde. Ziel war es, durch Bürgerwissenschaften Bürger für Wissenschaft und Luftqualität zu sensibilisieren, Lücken in den offiziellen Luftqualitätsdaten zu schließen und grüne Stadtpolitik zu fördern.
In Berlin führte das inter 3 Institut für Ressourcenmanagement drei Beteiligungsphasen durch; die letzte fand von Februar bis Mai 2024 statt. Jede Phase umfasste statische und mobile Messungen. Im statischen Teil nahmen 19 Personen an Messungen im verkehrsberuhigten Bellermannkiez sowie in zwei nicht verkehrsberuhigten Kiezen in Neukölln teil. Der Fokus lag darauf, die Auswirkungen der Verkehrsberuhigung auf die Luftqualität und den Verkehrsfluss zu untersuchen. Im mobilen Teil nahmen 45 Personen mit tragbaren Sensoren Messungen entlang ihrer Pendelwege per Fahrrad vor, um die Feinstaubbelastung zu erfassen.
COMPAIR ist ein technikaffines Projekt, bei dem Bürger selbst Feinstaub, Ruß und Verkehr mit Messgeräten erfassten. Der Schwerpunkt lag auf partizipativer Forschung: Wie kommen Bürger mit anspruchsvollen Sensoren zurecht und unter welchen Bedingungen sind ihre Daten valide und für Verwaltungen nutzbar? Die Ergebnisse zeigten, dass die von Bürger erhobenen Daten gut mit denen offizieller Messstationen übereinstimmen. Bürger wirkten durch Sensibilisierung und praktische Erfahrungen als Multiplikator in die Gesellschaft.
Auf der Konferenz stellen wir Projektdesign, Methoden sowie Richtlinien zum Datenaustausch und zur transparenten Kommunikation zwischen Projektinstitutionen und Bürger vor. Diese basieren auf den Zehn Prinzipien von Bürgerwissenschaften der European Citizen Science Association (ECSA) und den FAIR-Datenprinzipien. Wir werden diskutieren, welche Teile davon integriert wurden und welche Herausforderungen auftraten.
|