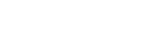Hintergrund: Partizipative Ansätze in der Gesundheitsforschung gewinnen an Bedeutung, da sie Patient*innen stärker in den Forschungsprozess einbinden und deren Bedürfnisse berücksichtigen. Patientenorganisationen (PO) sind für die Wissenschaft hierbei relevante Akteure, um partizipative Forschung umzusetzen. Trotz dieser Entwicklungen fehlen oft klare Leitlinien und Qualitätskriterien, um eine konsistente und effektive Beteiligung sicherzustellen. Verschiedene Forschungsnetzwerke haben bereits unterschiedliche Empfehlungen entwickelt, die auf konkrete partizipative Projekte angepasst werden müssen. Neuere Forschungsrahmenbedingungen in Deutschland und Europa fordern eine Integration von Patient:innendaten (z.B. PROMS), was zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt.
Ziele: Das Forschungsprojekt PANDORA „Patient*innenzentrierte Digitalisierung“ führe im Juni 2024 eine Stakeholder-Konferenz (SK) mit deutschen PO zur Erstellung eines Positionspapiers durch. Ziel ist es, die Perspektive der Patient*innen im wissenschaftspolitischen Diskurs der digitalen Gesundheitsforschung einzubringen und zu stärken. Aus diesem Prozess sollen zentrale Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die für bereits bestehende Leitlinien in der Forschungspraxis Berücksichtigung finden sollten.
Methoden: Ein interaktiver Diskursprozess vor und während einer SK im Juni 2024 bildet die Grundlage für die Erstellung eines Positionspapiers. Vor der SK wurden Stellungnahmen von allen PO/SHO zu den Kernthemen: Datensammlung, Sekundärdatennutzung, breite Zustimmung und aktive Mitgestaltung der digitalen Gesundheitsforschung, eingeholt. Aus den 40 eingegangenen Stellungnahmen wurden die Kernthemen geclustert. Basierend darauf fand eine 2-tägige moderierte SK statt. Ein Positionspapierentwurf wurde von den Teilnehmenden erarbeitet in den kommenden Woche finalisiert und von allen PO gezeichnet. Das finale Positionspapier wird im November 2024 politischen Entscheidungsträger*innen und der Öffentlichkeit präsentiert.
Panel-Teilnehmende und Perspektiven: Das Panel wird von Prof. Sabine Wöhlke und Prof. Silke Schicktanz geleitet und umfasst Beiträge von Paula Nadler (MA) sowie Thomas Duda (Stiftung Pro Retina). Diese werden die SK aus wissenschaftlicher, organisatorischer und Patient*innensicht vorstellen.
Ergebnisse: Der Diskursprozess verdeutlicht die praktische Umsetzung ethischer Überlegungen und dessen Übertragung in praxisnahe Forderungen. Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Perspektiven zu ethischen Fragen der Datennutzung, Zustimmung und Mitgestaltung, mit Schwerpunkt auf Patient*innenautonomie, Datenschutz und gleichberechtigtem Zugang.
Diskussion: Im Panel werden zentrale Handlungsempfehlungen der PO/SHO vorgestellt und aus unterschiedlichen Perspektiven zur Diskussion gestellt. Dabei soll auch auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen bereits existierenden Leitlinien sowie ihrer Umsetzbarkeit in der Forschungspraxis eingegangen werden. Evaluationskriterien sowie Methoden der Wirkungsforschung, können zukünftig helfen, Partizipationsprozesse zu verbessern.
Schlussfolgerung: Die erfolgreiche Umsetzung einer SK zeigt, wie PO/SHO aktiv an der Formulierung und Umsetzung ethischer Richtlinien für die partizipative Gesundheitsforschung beteiligt werden können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines integrativen Ansatzes und liefert ein Modell dafür, wie ethische Normen und Werte in die Forschung integriert werden können.