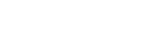Ist partizipative Forschung ein geeigneter Ansatz, um Wissenschaftsskepsis abzubauen - oder ist eine skeptische Grundhaltung nicht vielmehr Voraussetzung für einen ernsthaften und gleichberechtigten partizipativen Austausch?
Um sich diesen Fragen zu nähern, beleuchtet das Panel die Herausforderungen und Chancen der Wissenschaftskritik und ihre Rolle in der partizipativen Forschung. Während einerseits die Sorge über Wissenschaftsfeindlichkeit und die Zunahme von Verschwörungsnarrativen und Wissenschaftsskepsis in der Bevölkerung wächst, ist andererseits die kritische Auseinandersetzung mit akademischer Wissensproduktion und deren oftmals mangelnder Berücksichtigung von Wissensvielfalt, Diversität und Intersektionalität seit jeher inhärenter Bestandteil partizipativer Forschungsansätze. Hierarchien zwischen unterschiedlichen Wissensbeständen sollen in Frage gestellt werden, um einen multidirektionalen Wissensaustausch und eine gemeinsame und gleichberechtigte Wissensproduktion von wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Akteur:innen zu ermöglichen. Gerade die Beteiligung von Personen und Personengruppen, die sich in den gängigen wissenschaftlichen Kategorien, Theorien und Konzepten nicht wiederfinden und den Wissenschaften eher kritisch gegenüberstehen, birgt das Potenzial für neue Impulse zur Generierung von neuem oder anderem Wissen, innovativen Methoden sowie zur kritischen Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Auftrag von Wissenschaft, dem diesbezüglichen Status Quo des Wissenschaftsapparates, der eigenen Rolle als Wissenschaftler:in und den Bedingungen, unter denen Wissenschaft betrieben wird.
Das Panel besteht aus vier Vorträgen sowie einer abschließenden Diskussionsrunde.
Sebastian von Peter (Partizipative Versorgungsforschung in der Psychiatrie) wird sich mit den epistemischen Politiken der Wissenschaften im Bereich der psychischen Gesundheit beschäftigen, ausgehend von einem Verständnis von Wissen als „Intervention“ (statt Repräsentation). Anhand eines förderpolitischen und eines forschungspraktischen Beispiels wird er der grundsätzlichen Frage nachgehen, ob „neues Wissen“ nicht auch „neue Methoden“ erfordert.
Franka Schäfer (Performative Soziologie) argumentiert, dass Wissenschaftsskepsis nicht nur angebracht, sondern eine notwendige Bedingung performativer Soziologie ist, die mit methodischer Disziplinlosigkeit leitende Linien der Wissenschaft überschreiten will und zeigt anhand von Reallabor-Projekten, wie Wissenschaftsskepsis und -kritik in performativer Aktionsforschung produktiv gewendet werden können.
Philipp Schrögel (Wissenschaftskommunikationsforschung) stellt zur Diskussion ob einerseits das Feld der (partizipativen) Wissenschaftskommunikation in Forschung und Praxis nicht zu unwidersprochen von einem allzu positiven und positivistischen Wissenschaftsbild ausgeht? Und ob andererseits wissenschaftskritische Ansätze die Konkretheit und pragmatische Anschlussfähigkeit vermissen lassen? Als Antwort versucht sich der Impuls an einer Synthese beider Felder.
Julie Sascia Mewes (Science and Technology Studies, #WeDoSTS-Bewegung) reflektiert, wie Erfahrungen aus den partizipativen Wissenschaften produktiv für eine ‚Wissenschaftskritik von innen’ genutzt werden können. Am Beispiel von #WeDoSTS, einem internationalen Zusammenschluss wissenschaftspolitisch aktiver Wissenschaftler:innen im interdisziplinären Forschungsfeld STS, analysiert sie das transformative Potenzial partizipativer Ansätze und Methoden für das Engagement gegen unterschiedliche Formen von Machtmissbrauch und gruppenbezogener Diskriminierung im Wissenschaftsbetrieb.