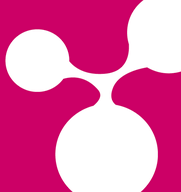GeNeMe 2025
Gemeinschaften in Neuen Medien
17. - 19. September 2025 in Dresden
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Mittwoch, 17.09.2025 | |
| 13:00 - 17:00 | Workshop Fostering Competence and Inclusion in VET through Digital Innovation Ort: MS1 + online ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Thomas Köhler Chair der Sitzung: Prof. Dr. Bruri Triyono M Chair der Sitzung: Jonathan Dyrna |
|
|
ID: 1170
/ Workshop: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Translation system, Indonesia sign language, deaf community Voice-to-Sign Translation System for Indonesian Sign Language: Enhancing Deaf Communication 1Department of Informatics Engineering,, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Manado, Indonesia; 2Department of Technological and Vocational Education, Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia Deaf individuals frequently rely on sign language to communicate, a sophisticated form of communication that represents a unique challenge for those unfamiliar with it. For people with hearing and speech impairments, sign language provides a crucial medium for expressing thoughts and emotions, yet this becomes problematic when those without sign language proficiency need to interact with them. The challenge lies in bridging this communication gap. This study introduces a system that converts spoken words or sentences into Indonesian Sign Language (SIBI) video sequences through a voice recognition interface. The developed system holds immense potential for various applications, including education and personal learning, allowing users to convert auditory inputs into visual sign language sequences. The system features a database of 3,368 basic Indonesian sign language words and letters, enabling smooth communication for everyday scenarios. The development process utilized the prototype methodology, while the system was evaluated using Blackbox-Testing, achieving an 84% success rate across 30 test scenarios. ID: 1125
/ Workshop: 2
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Learning Analytics, Digital Skills, Vocational Education, Systematic Review, Global Trends, Challenges, Future Education Learning Analytics and Key Digital Skills in Vocational Education: A Systematic and Bibliometric Review of Global Trends, Challenges, and Future Directions 1Department of Technological and Vocational Education, Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia; 2Department of Fashion Design Education, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia; 3Department of English Education, Faculty of Language, Art, and Culture, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia; 4Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia The accelerating pace of digital transformation has placed growing pressure on vocational education and training (VET) systems to equip learners with the digital competencies essential for the 21st-century workforce. Despite increasing attention, the literature remains fragmented in identifying the specific digital skills required, the role of learning analytics (LA) in supporting these competencies, and the global trends, challenges, and innovations surrounding their implementation in vocational education. Addressing this gap, the present study aims to explore five key research questions: (RQ1) What are the key digital skills required in vocational education to meet current and future workforce demands? (RQ2) How is learning analytics being utilized in vocational education to support the development and assessment of digital skills? (RQ3) What are the prevailing global trends in the integration and advancement of digital skills within vocational education systems? (RQ4) What are the main challenges faced by vocational education institutions and learners in acquiring and implementing digital skills? (RQ5) What future directions and innovative strategies can enhance the development and application of digital skills in vocational education? This study employs a systematic literature review method guided by PRISMA, analyzing 241 peer-reviewed articles published between 2019 and 2024 from the Scopus databases. The findings indicate a significant increase in research addressing digital skills and LA in VET, underscoring global urgency for digital readiness in the workforce. Ten core digital competencies were identified as critical for vocational learners: (1) basic digital literacy, (2) specific technology skills, (3) data management skills, (4) emerging technology skills (including AI, AR, VR, MR, and IoT), (5) digital communication, (6) cybersecurity literacy, (7) collaboration in digital environments, (8) creativity and problem-solving, (9) ethical information use and evaluation, and (10) digital leadership. Learning analytics emerges as a promising data-driven approach for enhancing instructional design, monitoring skill acquisition, and supporting personalized learning pathways in VET. However, its integration faces challenges such as limited digital infrastructure, inconsistent teacher competencies, and inadequate collaboration between education and industry sectors. As a response, the study proposes future strategies including adaptive curricula embedded with advanced technologies, targeted ICT-based teacher development programs, and strengthened multi-sector partnerships. This review contributes to the global discourse on the digital transformation of vocational education by offering empirical insights and practical recommendations to build responsive, inclusive, and future-ready VET systems. ID: 1163
/ Workshop: 3
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Health & Inclusion Stichworte: Kiken Yochi Training, Mobile Augmented Reality, Vocational Education, Occupational Safety, Systematic Literature Review Integrating Mobile Augmented Reality into Kiken Yochi Training in Vocational Education: A Systematic Literature Review 1Universitas Negeri Yogyakarta; 2Universitas Negeri Yogyakarta; 3Universitas Negeri Yogyakarta Kiken Yochi Training (KYT) is a critical method in occupational safety training, yet its implementation in vocational education faces challenges, particularly in risk visualization and learner engagement. Mobile Augmented Reality (MAR) offers potential to enhance KYT through interactive and immersive learning experiences. This study presents a systematic literature review using bibliometric analysis supported by Publish or Perish and VOSviewer to explore trends, challenges, and opportunities for integrating MAR into KYT in vocational education. Findings indicate that MAR improves situational awareness, engagement, and knowledge retention, although implementation is limited by infrastructure, instructor readiness, and the need for locally relevant content. These insights support the development of adaptive and contextual MAR applications for vocational settings. ID: 1164
/ Workshop: 4
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Electrical Circuit Training, Trainer Kit, Video Module, ADDIE Model Development of Electrical Circuit Training Design Based on Trainer Kit and Video Module Yogyakarta State University, Indonesia This study aims to develop an electrical circuit training design with the help of Trainer Kit and Video Module for students and college students who are relevant to the field of electrical engineering. The method used is Research and Development (R&D) with the ADDIE research model. The model goes through a 5-stage development procedure, namely (1) Analyze; (2) Design; (3) Development; (4) Implementation and (5) Evaluation. The data collection method uses interview instruments, documentation, literature studies and questionnaires with a Likert scale as the measuring instrument. The assessment of the level of feasibility uses 9 media and material evaluators. The results of the analysis in the study showed that the electrical circuit Trainer kit media obtained an average of 61.3 with the category "Very Feasible", the training material obtained an average of 56.6 with the category "Very Feasible", the video module obtained an average of 42.3 with the category "Very Feasible". Meanwhile, for the feasibility test of 16 student respondents, an average of 53.1 was obtained and entered the "Very Feasible" category. Thus, based on the results of research and development, the design of the training based on the Trainer Kit and video modules is very feasible to use. ID: 1167
/ Workshop: 5
Anwendungen aus der Praxis Themen: Track - Digital Education Stichworte: 21st Century Skills, Industry Collaboration, Teaching Factory Developing 21st Century Vocational School Teacher Skills Through Industry Collaboration in Teaching Factory Learning Universitas Negeri Yogyakarta |
| Datum: Donnerstag, 18.09.2025 | |
| 8:15 - 8:45 | Anmeldung Ort: A.106 Anmeldung Chair der Sitzung: Marlen Eisenberg Chair der Sitzung: Sara Amina Hennig Anmeldung für die GeNeMe-Konferenz |
| 8:45 - 9:00 | Begrüßung durch die Rektorin der Evangelischen Hochschule Dresden, Prof.in Silke Geithner Ort: A.104 Seminarraum 1, Do. ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Thomas Köhler Chair der Sitzung: Prof. Dr. Eric Schoop Chair der Sitzung: Prof. Dr. Ralph Sonntag |
| 9:00 - 10:00 | Keynote Prof. Dr. Nina Weimann-Sandig Ort: A.104 Seminarraum 1, Do. ZooM-Login Menschlichkeit im Algorithmus: Professionelle Identitäten im Zeitalter der KI. Menschlichkeit im Algorithmus: Professionelle Identitäten im Zeitalter der KI. |
| 10:00 - 10:15 | Pause |
| 10:15 - 12:00 | Digitale Partizipation Ort: A.104 Seminarraum 1, Do. ZooM-Login Chair der Sitzung: Dr. Jörg Neumann Chair der Sitzung: Denise Kuppek |
|
|
ID: 1138
/ DigIn: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Social Virtual Reality, Interaktionsqualität in digitalen Konferenzen Ist Social Virtual Reality eine geeignete Alternative für wissenschaftliche Konferenzen? Empirische Einblicke aus einer Pilotstudie 1AKAD University, IDEA; 2Dresden University of Technology, Center for Open Digital Innovation and Participation (CODIP) <p>In den heutigen Zeiten, die von der globalen Klimaerwärmung, schwindenden natürlichen Ressourcen und zunehmend bedrohter Biodiversität geprägt sind, ist ökologisches Handeln in allen Bereichen unserer Gesellschaft essenziell – auch in der Wissenschaft. Beispielsweise kann bei der Durchführung von akademischen Konferenzen ein signifikanter Umfang an Ressourcen, insbesondere für teils weite Anreisen mit Kraftfahrzeugen und Ressourcen, eingespart werden, indem diese online stattfinden (Welch et al., 2010). Der hierfür bislang etablierte Einsatz von Videokonferenzsystemen bringt jedoch diverse Einschränkungen, wie z. B. sehr eingeschränkte Interaktionsmöglichkeiten (Bonfert et al., 2022) und resultierende „Zoom-Müdigkeit“ (Fauville et al., 2023), mit sich, weswegen sogenannte Social-Virtual-Reality (VR)-Umgebungen hierfür zunehmend als Alternative erprobt werden. Bisherige Pilotstudien dazu zeigen eine tendenziell hohe Akzeptanz, Erlebnisqualität und Zufriedenheit mit solchen Formaten (z. B. Ahn et al., 2021; Dyrna et al., 2023; Kirchner & Nordin Forsberg, 2021; Zender & Mulders, 2022), nehmen jedoch nur wenig Bezug auf ihre Vor- und Nachteile gegenüber Durchführungen per Videokonferenz oder in Präsenz sowie auf spezifische Kriterien der Interaktionsqualität, die für den Erfolg solcher Veranstaltungen von maßgeblicher Bedeutung sein dürften. Um dem zu begegnen, wurde eine weitere Pilotstudie durchgeführt, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (<em>N</em> = 34) an einer zweitägigen Fachkonferenz in Social VR teilnahmen und dazu anschließend einen standardisierten Fragebogen beantworteten Er setzte sich aus gebundenen Fragen mit validierten (z. B. Task-Technologie-Fit-Scale; Howard & Rose, 2019) und eigenkonstruierten Skalen, u. a. zur individuellen Formatpräferenz sowie wahrgenommenen Interaktionsmöglichkeiten und -potentialen, und einer offenen Frage zu Vor- und Nachteilen des Formats zusammen. Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt hohe Teilnahmefreude und wahrgenommene Eignung des Veranstaltungsformats. Folglich würden im Falle einer Wahl fast so viele Teilnehmende eine Social-VR-Variante (38 %) präferieren wie eine Präsenzveranstaltung (47 %), während Videokonferenzsystem deutlich weniger Fürsprache (15 %) finden. Gründe hierfür liegen neben der grundlegenden Zeitersparnis, Ortsunabhängigkeit und Barriere-Reduktion durch Online-Formate vor allem im stärkeren räumlich-sozialen Erleben und einem hohen Wohlbefinden bei Teilnahme und Interaktion. Es wird jedoch auch deutlich, dass die Interaktionsqualität dabei, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten zum informellen sozialen Austausch zwischen den Teilnehmenden, u. a. durch die begrenzten Möglichkeiten für die individuelle Kommunikationsgestaltung und non-verbale Signale gegenüber Präsenzveranstaltungen zurücksteht. Hier sollten Forschung und Praxis gemeinsam anknüpfen, um sowohl bestehende Social-VR-Werkzeuge als auch Veranstaltungskonzepte hierfür empirisch begleitet zu optimieren.</p> ID: 1158
/ DigIn: 2
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: Community-Konzept, Mixed-Method, Online-Plattform, Bildungsplattform, Ko-Konstruktion von Wissen, Community of Practice, Lehrpersonen, Bildungsadministration, Schulnetzwerke, iterative Entwicklung Partizipative Entwicklung einer kollaborativen bundeslandübergreifenden Bildungsplattform für Lehrer:innen: Erste Ergebnisse des Community-Konzepts 1Technische Universität Dresden, Deutschland; 2Universität Leipzig; 3Pädagogische Hochschule Karlsruhe <p>In der zweiten Phase der Bund-Länder Initiative „LemaS-Transfer in die Schullandschaft“ entsteht eine Online-Plattform zur bundeslandübergreifenden Vermittlung der LemaS-P³rodukte (BMBF, 2021), die Strategien, Konzepte, Maßnahmen und Materialien zur Förderung (potenziell) leistungsstarker Schüler:innen umfassen (LemaS Glossar, 2025). Für den praktischen Einsatz durch Lehrpersonen ist eine aktive Auseinandersetzung damit notwendig (Hascher, 2014). Der Beitrag fokussiert die iterative Entwicklung (vgl. Design-Based-Research (DBR) Ansatz; Reinmann, 2017) eines dafür geeigneten Community-Konzepts unter Partizipation verschiedener User-Gruppen (Schulentwicklung in Netzwerken vgl. Marx/Pant, 2022). Es wird aufgezeigt wie der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Technologien in Bildungs-Communities im Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis erfolgen kann. Die Entwicklung der LemaS-Plattform und des Community-Konzeptes basiert auf einem mehrstufigen Mixed-Method-Vorgehen, unter Einbezug agiler Arbeitsmethoden. In explorativen Kleingruppengesprächen wurden erste Bedarfe erfasst und in User-Stories formuliert (Wirdemann ,2022). Darauf aufbauend und in Rückbezug auf theoretische Annahmen zur online Wissensvermittlung (Roos, 2022) sowie Austauschformaten (u.a. Multiplikatorenmodell vgl. Behr et al., 2020; CoP vgl. Kreutzmann, 2022) wurde ein Wireframe entwickelt, der eine Kurslogik zur Vermittlung der LemaS-P³rodukte mit ergänzender Community im Social Media Design abbildete. Angelehnt an den DBR Ansatz, wurde der Wireframe in einer ersten Iterationsschleife in Bezug auf die User Experience und Usability getestet (UEQ, Schrepp, 2023; SUS, Brook, 1996). Die qualitative Erhebung erfolgte durch Fokusgruppengespräche in Workshops, bei denen das Wireframe Lehrpersonen (z.T. Multiplikationsfunktion, Behr et al. 2020), Schulleitungen, Vertretende der Bildungsadministration und technischem Personal sowie Wissenschaftler:innen des Projektes gezeigt wurde. Die Diskurse wurden durch teilnehmende Beobachtung dokumentiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass es einen starken Bedarf an kollaborativen Arbeitsräumen und Austauschformaten zur Unterstützung der Professionalisierung gibt, im Sinne der Ko-Konstruktion von Wissen (Grosche et al., 2020; Klein et al., 2024, Gräsel et al., 2006). Soziale Community-Funktionen spielen hingegen eine untergeordnete Rolle. Als besonders herausfordernd gilt der Anspruch die Plattform mit Community in die föderalen Strukturen zu integrieren, bezugnehmend auf die unterschiedlichen Bildungssysteme, technischen Infrastrukturen und administrative Auffassungen. Ebenso wie die an der Initiative beteiligten 18 Hochschulen und über 800 Schulen aus allen 16 Bundesländern. Der Beitrag zeigt die Entwicklung des Community-Konzepts anhand erster Ergebnisse des iterativen Designprozesses und diskutiert mögliche Implikationen zur Gestaltung von Community-Räumen für bundesweite Online-Angebote im Bildungsbereich.</p> ID: 1148
/ DigIn: 3
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Fernlehre, flipped classroom, digitale Tools, menschenzentrierte Interaktion, education Förderung sozialer Interaktion an Fernhochschulen mit Hilfe digitaler Tools Hamburger Fern-Hochschule, Deutschland <p>Einleitung: Die deutsche Hochschullandschaft hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, neben klassischen Präsenzstudiengängen gewinnen digitale Formate zunehmend an Bedeutung. Inzwischen haben sich verschiedene Formen der online und hybriden Lehre entwickelt. Durch diese kann auf die Diversität der Studierendenschaft und deren Bedürfnis nach Zeit- und Ortsunabhängigkeit beim Studieren besser eingegangen werden. Hierbei hat sich das Modell des Fernstudiums etabliert, welches Präsenzangebote mit online und hybriden Tools kombiniert. In Deutschland gab es im Wintersemester 2023/24 über 250 000 Fernstudierende (Hübsch, 2024). Aus der dargestellten Ausgangslage ergibt sich die Forschungsfrage „Wie kann in verschiedenen Lernsettings an Fernhochschulen durch digitale Tools menschenzentrierte Interaktion ermöglicht werden?“</p> <p>Methodik: Bei einer im Jahr 2024 durchgeführten Online-Umfrage von über 800 Studierenden an einer deutschen Fernhochschule wurden zunächst die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden erfragt, insbesondere hinsichtlich der Integration von Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Chatbots in die Lehre. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Förderung der Vernetzung von Studierenden mit Hilfe verschiedener digitaler Tools. Für die Befragung wurden zunächst wissenschaftliche Arbeiten zur Online-Lehre analysiert, auf deren Basis der verwendete Fragebogen entwickelt wurde. Die Auswertung erfolgte mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.</p> <p>Die Ergebnisse zeigen ein differenziertes Bild: Circa 90 Prozent der Studierenden wünschen sich Flexibilität und Selbstbestimmung beim Studieren, jedoch kritisieren viele Studierende gleichzeitig das Fehlen sozialer Interaktionen. Zudem äußerten einige Teilnehmende den Wunsch nach innovativen Formaten, wie VR, AR und den Einsatz von Chatbots, um die Lernumgebung interaktiver zu gestalten. Mit Hilfe der gewonnen Ergebnisse wurde das flipped-classroom Modell von Sein-Echaluce et al weiterentwickelt – siehe Abbildung 1. Welches darauf abzielt, die soziale Interaktion an Fernhochschulen zu fördern.</p> <p>Diskussion: Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen weitgehend aktuelle Trends und zeigen auch neue Impulse für die Weiterentwicklung digitaler Lernangebote auf. Die Einbindung von VR-Technologien und KI-gestützten Tools wird zukünftig verstärkt eine Rolle in der Lehre spielen, was sich unproblematisch in das entwickelte Modell integrieren lässt. Kritisch ist zu betrachten, dass die Ergebnisse der Studie auf der Erhebung an nur einer Institution beruhen, was die Übertragbarkeit begrenzt.</p> ID: 1115
/ DigIn: 4
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: virtual communities, online community platform, online learning, networking, nuclear power sector Identifying Key Features and User Experience Criteria for an Online Social Learning Community Platform in the Nuclear Power Sector 1Technische Universität Dresden, Center of Interdisciplinary Digital Sciences; 2Technische Universität Dresden, Chair of Educational Technology; 3Technische Universität Dresden, Chair of Media Education; 4actimondo eG <p>The current decommissioning of nuclear power plants in Germany is a complex and long-term process that requires specialist staff. However, appropriate programs to qualify such personnel have declined massively since the nuclear phaseout in 2023, plus a substantial number of employees will retire in the next few years (Kettler et al., 2025). To nevertheless keep training decommissioning experts, we consider developing and establishing a domain-specific community platform a promising approach where future staff can acquire competencies through web-based formats and by connecting and collaborating with peers and, in particular, experts. A community platform refers to a social learning platform for a (learning) community of practice (e.g., Pyrko et al., 2019) that integrates features for news, communication, and collaboration with (references to) educational programs and resources as well as directories of institutions, experts, or projects. However, few such complex platforms (e.g., LinkedIn Learning) exist, and sound domain-specific design principles are missing, in particular for the nuclear power sector. In this regard, established models like the Technology Acceptance Model (TAM; Davis, 1989; Venkatesh & Bala, 2008) suggest that users are likely to accept and use emerging technologies when considering them highly useful and easy to use. Consequently, we aim to investigate how a community platform (for the nuclear power sector) can be designed to maximize perceived usefulness, user experience, and, consequently, user acceptance. to tackle this issue and ensure user-centered design, we carried out two studies. Addressing user-friendliness prerequisites, we first performed qualitative shadowing (McDonald, 2005) by observing user experience experts and novices (<em>N</em> = 5) participating in task-based user trials with a comparable platform and subsequently conducting in-depth interviews. Findings, in particular, show that the seamless integration of the platform areas, an intuitive search function, and the free accessibility of all basic functions contribute to high ease of use. To explore usefulness requirements, we conducted a standardized survey, including questions from the TAM questionnaire (Davis, 1989) and opened-ended questions, to assess future users’ perceived usefulness and use intention of potential platform features. In short, preliminary results of the currently still ongoing survey indicate that potential users (<em>N</em> = 35), including nuclear power scientists, project engineers, and managers, find rather conventional educational resources like specialist publications, learning materials, and directories of training courses, particularly useful while being more reserved towards social features like a personalized feed, an event management system, or a messaging service. Results provide fruitful design recommendations for the planned nuclear power community platform and indicative guidelines for designing and optimizing comparable platforms.</p> |
| 10:15 - 12:00 | Digital Education: AI (engl.) Ort: A.103 Seminarraum 2, Do. ZooM-Login Chair der Sitzung: Dr. Peter Döppler Chair der Sitzung: Emma Maria Weidner |
|
|
ID: 1120
/ DigEd - AI: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Emotion Recognition, AI Mentoring, Animated Avatars, FER2013, Multimodal Interaction, OpenGL, Responsible AI, Design-Based Research Emotion-Aware AI Avatars for Personalized Learning Support Using Multimodal Interaction ScaDS.AI, Technische Universität Dresden, Deutschland <p>This contribution presents a human-centered AI mentoring system that combines animated avatars, real-time emotion detection, and dialogically grounded learner support to foster emotionally intelligent interaction in digital education. The system addresses a key challenge in online learning: the absence of socio-emotional feedback loops between learners and educators (Salloum et al., 2025; D’Mello & Graesser, 2013). At its core is a 2D avatar rendered in real time via OpenGL, controlled through a Python-based framework. The avatar adapts facial expressions and gestures based on multimodal emotion recognition using CNNs trained on FER2013. Visual cues are derived from facial and audio signals to represent and respond to learner affect, enhancing trust and engagement through social presence. The mentoring process begins with a narrative-based onboarding procedure that captures learners’ experiences and goals across 14 biographical dimensions (Hummel & Donner, 2024). The resulting profile combines formal, informal, and transversal competencies (Crasovan, 2016; Egger & Hummel, 2020), forming the basis for personalized mentoring. A Retrieval-Augmented Generation (RAG) pipeline and Learning Record Store (LRS) allow adaptive feedback, content suggestions, and timely interventions. Grounded in relational learning theory (Prange, 2005; Koller, 2023), the system frames mentoring as a co-constructed process. The avatar functions not as an instructor but as a reflective, supportive learning companion, promoting agency and self-regulation over performance optimization. Unlike conventional avatar-based tutor bots, our system integrates narrative goal setting and affective responsiveness rooted in educational theory. Methodologically, the contribution builds on a design-based research framework. A formative study with 20 higher education students explores user trust, perceived support, and acceptance via interaction data and qualitative feedback. To ensure ethical alignment, the system integrates federated learning, transparent consent protocols, and privacy-aware data use (de Witt et al., 2023). It deliberately avoids surveillance-based logic, emphasizing human dignity and autonomy in digital mentoring contexts. Future iterations aim to extend the system beyond higher education and examine its transferability across diverse learning domains and populations.</p> ID: 1152
/ DigEd - AI: 2
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Lesson preparation, artificial intelligence, digital skills, teacher training “Hey AI, how can I design my lesson for tomorrow?”. First insights into pre-service teachers’ use of artificial intelligence for lesson planning. 1TUD Dresden University of Technology, Chair of Educational Technology; 2TUD Dresden University of Technology, Center for Open Digital Innovation and Participation; 3TUD Dresden University of Technology, Chair of Media Education <p>The rapid development and spread of artificial intelligence (AI) are currently transforming a multitude of occupational areas, and are in consequence also increasingly impacting professional activities in the field of education. Especially for school teachers, who are facing mounting challenges due to student behavior, large and heterogeneous classes, and increasing bureaucracy (e.g., Sichma & Wolf, 2023), AI not only poses new demands, but also offers a variety of opportunities to facilitate their work, in particular during lesson planning and implementation.</p> <p>According to a recent pilot study, teachers are already using AI for certain professional activities like brainstorming ideas, adapting and summarizing text-based materials, and creating tasks for both formative and summative assessments (Pettera et al., 2024). However, we still know very little about how prospective teachers currently use basic and complex features of AI to particularly plan and prepare lessons. General competency models such as the Artificial Intelligence Competence Model (AIComp; Ehlers et al., 2023) describe basic AI competencies. However, there has so far been a lack of specific adaptation and operationalization of such models for concrete professional application contexts in the education sector - for example for lesson planning.</p> <p>To provide empirical evidence on this issue, a qualitative study was conducted to investigate the use of AI during a planning task of a 90-minute lesson on the topic of “Coffee as a cultivated plant” by three pre-service teachers. For this purpose, a research instrument was first developed that depicts activities relevant to operationalize (levels of) AI competence specifically for the case of lesson planning on the basis of the AIComp model. It was then used during observing participants’ visible actions and analyzing their Chat history. In a subsequent qualitative content analysis, students’ activities were coded according to the dimensions of lesson planning by Klafki (2007).</p> <p>The study's findings suggest that pre-service teachers mainly use AI during the conceptual phase of lesson planning, in particular to generate ideas and to methodically design their lessons (e.g., by defining learning objectives and meaningfully integrating digital media). However, more complex tasks like creating handouts or multimedia learning materials were rarely performed using AI.</p> <p>The results indicate that the AI skills of trainee teachers are still limited and underline the need for further research into the causes and for targeted media didactic training in the context of teacher training. The measuring instrument used provides a suitable basis for structuring learning content. It can be used in future studies both to assess the level of knowledge and for targeted support and at the same time provides impulses for the well-founded development of an instrument for recording AI skills in this professional field.</p> ID: 1131
/ DigEd - AI: 3
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Prompt Engineering, Educational Chatbots, Generative AI, LLM Evaluation, Pedagogical Coherence, Responsible AI, GPT-4, Instructional Design Prompt Engineering in Educational AI: A Benchmark Study on the Pedagogical Performance of Large Language Models ScaDS.AI, Technische Universität Dresden, Deutschland <p>Prompt engineering plays an increasingly central role in shaping the instructional value of generative AI systems in education (Bartok et al., 2023; Bates et al., 2020; Hummel & Donner, 2023). Yet empirical evidence on how different prompt strategies influence the pedagogical quality of AI-generated responses remains scarce (Cain, 2023; White et al., 2023; Bender et al., 2021). Addressing this gap, the present study conducts a controlled benchmarking experiment comparing three prompt formats - generic, role-based, and iteratively optimized - within a GPT-4-powered educational chatbot. A total of <em>n = 56</em> prompts derived from authentic learner questions served as the basis for a multidimensional evaluation framework that integrates semantic coherence assessed via BERTScore (Zhang et al., 2020), readability and fluency via METEOR (Banerjee & Lavie, 2005), contextual appropriateness through LLM-based meta-evaluation (Fu et al., 2023), and conceptual depth via structured, double-blind expert ratings (<em>n = 5</em>). While generic prompts often produce fluent surface-level responses, iteratively optimized prompts consistently achieve higher scores across all dimensions, particularly in terms of pedagogical alignment and instructional depth. Theoretically, the study is grounded in constructivist and relational learning theories (Koller, 2023; Prange, 2005), viewing prompts not merely as input strings but as didactic mediators that shape instructional interaction, dialogical quality, and learner agency. Drawing on educational psychology and instructional design (Casovan, 2016; Zawacki-Richter et al., 2019), we argue that deliberate prompt formulation enables more meaningful, responsive, and personalized AI-assisted learning (Zhang & Aslan, 2021). Ethical dimensions - including transparency, contextual sensitivity, and bias mitigation - are operationalized in accordance with Responsible AI principles (de Witt et al., 2023), ensuring that evaluation processes remain aligned with pedagogical and normative concerns. The study contributes a replicable framework for prompt benchmarking in educational AI, empirically substantiates the relationship between prompt structure and pedagogical quality, and reframes prompt engineering as an instructional design practice situated at the intersection of educational intention and technical realization.</p> |
| 12:00 - 13:00 | Mittagspause |
| 13:00 - 15:30 | Rundgang ehs (Gruppe 1 - Rot) Ort: Gruppe 1 (Rot) 13:00 - 13:50 Uhr Rundgang im Simulationslabor Pflege Alisa Trummer (ehs) 13:50 - 14:40 Uhr Achtsamkeit in digitalen Gemeinschaften - erholsamer Spaziergang Sandra Richter (ehs) 14:40 - 15:30 Uhr Miteinander in digitalen Gemeinschaften - eine interaktive Session Silke Geithner (ehs) 13:00 - 13:50 Uhr Rundgang im Simulationslabor Pflege Alisa Trummer (ehs) 13:50 - 14:40 Uhr Achtsamkeit in digitalen Gemeinschaften - erholsamer Spaziergang Sandra Richter (ehs) 14:40 - 15:30 Uhr Miteinander in digitalen Gemeinschaften - eine interaktive Session Silke Geithner (ehs) |
| 13:00 - 15:30 | Rundgang ehs (Gruppe 2 - Blau) Ort: Gruppe 2 (Blau) 13:00 - 13:50 Uhr Miteinander in digitalen Gemeinschaften - eine interaktive Session Silke Geithner (ehs) 13:50 - 14:40 Uhr Rundgang im Simulationslabor Pflege Alisa Trummer (ehs) 14:40 - 15:30 Uhr Achtsamkeit in digitalen Gemeinschaften - erholsamer Spaziergang Sandra Richter (ehs) 13:00 - 13:50 Uhr Miteinander in digitalen Gemeinschaften - eine interaktive Session Silke Geithner (ehs) 13:50 - 14:40 Uhr Rundgang im Simulationslabor Pflege Alisa Trummer (ehs) 14:40 - 15:30 Uhr Achtsamkeit in digitalen Gemeinschaften - erholsamer Spaziergang Sandra Richter (ehs) |
| 13:00 - 15:30 | Rundgang ehs (Gruppe 3 - Grün) Ort: Gruppe 3 (Grün) 13:00 - 13:50 Uhr Achtsamkeit in digitalen Gemeinschaften - erholsamer Spaziergang Sandra Richter (ehs) 13:50 - 14:40 Uhr Miteinander in digitalen Gemeinschaften - eine interaktive Session Silke Geithner (ehs) 14:40 - 15:30 Uhr Rundgang im Simulationslabor Pflege Alisa Trummer (ehs) 13:00 - 13:50 Uhr Achtsamkeit in digitalen Gemeinschaften - erholsamer Spaziergang Sandra Richter (ehs) 13:50 - 14:40 Uhr Miteinander in digitalen Gemeinschaften - eine interaktive Session Silke Geithner (ehs) 14:40 - 15:30 Uhr Rundgang im Simulationslabor Pflege Alisa Trummer (ehs) |
| 15:30 - 16:45 | Digitale Interaktion: KI Ort: A.104 Seminarraum 1, Do. ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Daniel Markgraf Chair der Sitzung: Dr. Kerstin-Kathy Meyer-Ross Chair der Sitzung: Michaela Ludwig |
|
|
ID: 1127
/ DigIn - KI: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: Smart Learning Experiences, KI-gestützte Lernarrangements, Interaktionsanalyse act4teams, Didaktisches Sechseck KI-gestützter Interaktionen Verlieren wir nun endgültig das Miteinander? - KI-gestützte Lernsituationen aus der Sicht der Interaktions- und Kommunikationsforschung TU Dresden, Deutschland <p>Die moderne KI-Forschungsoffensive, insbesondere im Bildungsbereich, fördert die Integration neuer KI-Strategien in etablierte Sozialstrukturen, da der Umgang mit Künstlicher Intelligenz entscheidend für die berufliche Kompetenzentwicklung ist [1,2,3]. Dies wird jedoch oft durch die Skepsis gegenüber generativen KI-Tools, die als Bedrohung für zwischenmenschliche Interaktionen wahrgenommen werden, gehindert [4,5,6]. Doch wie lässt sich diese Aversion zielführend in die bildungswissenschaftliche Forschung einbinden?</p> <p>Der vorliegende Beitrag analysiert KI-gestützte Gruppendynamiken quasi-experimentell in beruflichen Lernsituationen, diskutiert diese aus der Perspektive beruflicher Interaktionsforschung und synthetisiert die Erkenntnisse in einem Modell KI-gestützter Interaktionen.</p> <p>Hybride soziale Interaktionen zwischen menschlichen und algorithmischen Akteuren – beispielsweise Computervermittelte Kommunikation (CMK) und KI-gestützte Kommunikation (KIGK) [10,11] – haben einen besonderen Stellenwert in den Sozialstrukturen der Digitalität [13,18,21,22]. Das Konzept der Smart Learning Experiences (SLXs), siehe Abb. 1, hat daher zum Ziel, die digitale Partizipationskompetenz (DPK) zu entwickeln [8, 12]. Dieses pädagogische Planungs- und Reflexionskonzept modifiziert daher bestehende Modelle der Didaktik [7] und Kompetenzentwicklung [1,2] für die Schulbildung.</p> <p>Zur statistischen Erkundung solcher KIGK im Rahmen der Smart Learning Experiences, wird eine auf dem SLXs-Konzept basierte KI-gestützte Lernsituation (Abb. 2) im Sektor der (bau-)technischen Berufsausbildung quasi-experimentell untersucht. Die darin stattfindende Team-KIGK wird mittels der act4team-Interaktionsanalyse [20, 23] beobachtet, protokolliert und deskriptiv ausgewertet.</p> <p>Die skizzierten Mittelwerte erhobener Daten (Abb. 3) zeugen von einer Zielgerichtetheit und Zweckmäßigkeit KI-gestützter Kommunikation, ähnlich den Ergebnissen beruflicher Interaktionsforschung [9,10,12,13]. Die identifizierte Zirkularität der KIGK spiegelt sich in der Fluidität der Interaktionskategorien wider und folgt ebenso Befunden, die grundlegende Prinzipien der Kommunikation auf CMK und KIGK ausweiten [16]. Die protokollierte Komplexität der KIKG stellt besondere Bewältigungsmechanismen der Digitalität dar [17,14]: Räumliche und zeitliche Asynchronität, erweiterte Konvergenzen und Personalisierungsmodalitäten lassen sich in Ergebnissen anderer Interaktionsstudien wiederfinden [14,15,21].</p> <p>Daraus ergibt sich eine klare Verneinung der Titelfrage und damit eine Notwendigkeit, die Aversion gegenüber disruptiven Einflüssen von KI-Technologien proaktiv aufzugreifen. Eine Lösung bietet das entwickelte Modell „Didaktisches Sechseck KI-gestützter Interaktionen“ (Abb. 3). Es dient als eine Entwicklungsstufe zwischen den konventionellen didaktischen Interaktionsmodellen [19] und dem AIMC-Modell unabhängiger beruflicher KI-Umgebungen [16] und koppelt so das „disruptive Unbekannte“ mit bekannten Interaktionsstrukturen.</p> ID: 1139
/ DigIn - KI: 2
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education Stichworte: Instructional Design, Mensch-KI-Interaktion, Selbstgesteuertes Lernen Prompt, Prozess und Person. Anwendungspraktische Erkenntnisse für den reflektierten Einsatz von KI im Instruktiondesign Technische Hochschule Lübeck, Deutschland <p>Instruktionsdesign ist ein komplexer, technologieaffiner und reflexionsorientierter Prozess, der die didaktische Konzeption, Medienproduktion und technische Implementierung digitaler Lehr-Lern-Arrangements umfasst – und daher vom transformativen Wandel durch KI besonders betroffen ist. Der Einsatz von KI-Werkzeugen verändert nicht nur, was getan wird, sondern vor allem, wie es getan wird. Im Mittelpunkt des Beitrags steht daher die Frage, wie die Integration KI-gestützter Werkzeuge den Instruktionsdesign-Prozess und die Rolle der Beteiligten verändert.</p> <p>Am Institut für Interaktive Systeme der Technischen Hochschule Lübeck wurden früh Strukturen geschaffen, die Mitarbeitenden Raum zur Erprobung und Selbstreflexion im Umgang mit KI-Werkzeugen bieten. Im Rahmen des Forschungsprojekts European-Digital-Innovation Hub (EDIH.SH) entstand eine Fallstudie, die untersucht, wie verschiedene KI-Werkzeuge in den unterschiedlichen Phasen des Instruktionsdesign-Prozesses eines mehrsprachigen Selbstlernangebots didaktisch reflektiert eingesetzt werden können. Dabei wird KI von den Instruktionsdesignenden zunehmend als Co-Designender wahrgenommen, was Auswirkungen auf Rollenverständnis, Verantwortung und die Zusammenarbeit zwischen Fachexpert*innen, Instruktionsdesignenden und Medienproduzierenden hat.</p> <p>Die qualitative Reflexion des strukturierten Einsatzes der KI-Werkzeuge ergab unter anderem:</p> <ul> <li>In der didaktischen Konzeptionsphase agieren Fachexpert*innen vermehrt als Qualitätsprüfende, während Instruktionsdesignende durch den Einsatz generativer KI als zusätzlicher „Autor“ mehr inhaltliche Verantwortung übernehmen.</li> <li>In der Medienproduktionsphase können KI-generierte Avatare in Lernvideos Inhalte präsentieren (etwa als Fallbeispiele). Dennoch ist aufgrund des technischen Entwicklungsstands und des Neuheitswertes ein didaktisches Framing durch eine „Real-Lehrperson“ aktuell sinnvoll.</li> <li>In der technischen Implementierungsphase beeinflusst die individuelle Expertise der Instruktionsdesignenden maßgeblich, ob und wie KI-Werkzeuge – beispielsweise als Coding-Partner – eingesetzt werden.</li> <li>Die Multilingualität des Selbstlernangebots spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie die eingesetzten KI-Werkzeuge während des Instruktionsdesign-Prozesses ineinandergreifen.</li> </ul> <p>Der Beitrag gibt einen anwendungsspraktischen Einblick in das Nebeneinander von Mensch und KI im Instruktionsdesign-Prozess und formuliert erste Thesen für einen lösungsorientierten und didaktisch reflektierten KI-Einsatz. Er versteht sich als Einladung zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit, hybride Mensch-KI-Kollaboration, transparente KI-Nutzung und reflektierten KI-Einsatz in digitalen Lernangeboten zusammenzudenken.</p> ID: 1144
/ DigIn - KI: 3
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Interaction Stichworte: Social Media, Sentiment Analysis, Negativity Detection, ChatGPT, Artificial Intelligence [Online] The Potential of ChatGPT for Sentiment Analysis of Social Media Conversations Universität Paderborn, Deutschland Social networks can significantly influence users' well-being, underscoring the need to identify and address the negative effects of social media use. In turn, recognizing and reducing harmful structures in digital communication is essential for fostering a healthier discourse and proposing potential interventions. Addressing this concern, this study investigates the potential of ChatGPT as a sentiment analysis tool for detecting negative patterns in social media conversations. Its effectiveness is assessed through quantitative and statistical analysis of specific datasets and compared against alternative sentiment analysis approaches. A growing body of research examines ChatGPT’s potential for artificial intelligence (AI)-supported text analysis, often showing promising results, but differing across domains, e.g., Amin et al. (2024); Wang et al. (2023); Bang et al. (2023); Mets et al. (2024); Rathje et al. (2024); Mousavi et al. (2024); Lossio-Ventura et al. (2024); Fatouros et al. (2023); Belal et al. (2023). Such previous evaluations of ChatGPT have primarily focused on a narrow range of tasks within the field of affective computing. Given the broad scope of this domain, this study aims to provide a more comprehensive assessment of ChatGPT’s capabilities across a diverse set of tasks. We specifically assess the use of ChatGPT for AI-based identification of several pre-identified negative structures in social media conversations. The findings show that ChatGPT is generally effective at identifying complex semantic and syntactic patterns. Thanks to its extensive training data, it can uncover implicit sentiments in both text and image input. Furthermore, its ability to explain these patterns in follow-up dialogues offers a distinct advantage over traditional sentiment analysis tools. However, the study also identifies clear limitations in ChatGPT’s application possibilities, as it does not perform reliably across all use cases. Our analysis reveals both the strengths and weaknesses of ChatGPT as a sentiment analysis system, highlighting scenarios where it is well suited to be used and where its use is not recommended. This study contributes to a deeper understanding of negative dynamics in social networks by demonstrating how conversational AI like ChatGPT can deliver rapid, insightful analyses of text-based communication. By identifying suitable and unsuitable contexts for its application, the research opens new avenues for integrating automated analysis into the broader field of computational social communication sciences. ChatGPT enables researchers and stakeholders to efficiently process and interpret large datasets from various sources, offering clear, data-driven insights, including the evaluation of patterns and correlations that may not be readily apparent through manual analysis. Its adaptability also allows for fine-tuning to meet specific research goals, making it possible to create more personalized and context-sensitive applications. |
| 15:30 - 16:45 | Digital Education (engl.) Ort: A.103 Seminarraum 2, Do. ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Helge Fischer Chair der Sitzung: Sara Amina Hennig |
|
|
ID: 1105
/ DigEd (engl.): 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Digital competence; DIGCOMP Framework; Engineering Students; [Online] Analyzing Digital Competences of Engineering Students: Framework and Results of an International Research Proposal 1Universidad Autónoma de Chile, Santiago-Talca-Temuco, Chile; 2TU Dresden, Institute for Further and Continuing Education, Deutschland; 3Technische Universität Dresden, CODIP-Zentrum, Dresden, Deutschland The COVID-19 pandemic has profoundly influenced society and educational in-stitutions, particularly within universities. It has hastened the integration of digi-tal technologies (ICT) into both teaching and learning methods, significantly al-tering educational delivery, especially through online platforms. This study seeks to explore how university students assess and interpret their Digital Competen-cies (DC) according to the DIGCOMP framework introduced by the European Union in 2020. A survey was crafted and distributed to 335 engineering students from a multi-campus university in Chile during the years 2022 to 2024. The re-search adopts a quantitative and descriptive approach, concentrating on five areas of digital competencies: (1) Information and data literacy; (2) Communication and collaboration; (3) Digital content creation; (4) Security; and (5) Problem-solving. ID: 1146
/ DigEd (engl.): 2
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: Future Skills, Hackathon, Higher Education, Project-Based Learning, Competence Development, International Collaboration Building Future Skills: Insights from a Five-Day International Hackathon 1Technische Universität Dresden, Germany; 2Otto Group one.O The rapid digital transformation and global labor market dynamics demand that higher education institutions foster competencies beyond disciplinary expertise. Hackathons, as intensive and collaborative innovation formats, are increasingly recognized as promising environments for the development of Future Skills according to the Future Skills Framework by Ehlers (2020). This paper presents the design and evaluation of a five-day international hackathon conducted with students from Stellenbosch University (South Africa) and TU Dresden (Germany). The event challenged participants to collaboratively design AI-based prototypes for email classification and response automation, supported by cloud-based tools and iterative feedback loops. Employing a quantitative pre-post survey (n = 10), the study assessed students’ self-perceived competence development across seven Future Skills domains, using adapted scales for digital literacy, communication, ambiguity tolerance, design thinking, collaboration, and self-determination. While no statistically significant differences emerged, small-to-medium effect sizes indicated practical gains in digital literacy and ambiguity tolerance, complemented by the diversity of student-built technical solutions. The findings highlight three contributions: (1) the hackathon design as a competence-centered, transferable learning format, (2) the student-developed prototypes as artifacts reflecting divergent yet functional solutions, and (3) preliminary evidence of hackathon participation as a catalyst for Future Skills development. Limitations due to the small sample size and reliance on self-reports are acknowledged, and recommendations for future iterations include larger cohorts, qualitative interviews, and log-data analyses. The study demonstrates the potential of international hackathons to foster Future Skills in authentic, cross-cultural learning environments and calls for further empirical exploration of their long-term effects. ID: 1128
/ DigEd (engl.): 3
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: EFL teachers, AI-powered technologies, ChatGPT, ethical considerations Iranian EFL Teachers’ Perceptions of Using ChatGPT for Improving English Language Learning 1Hazrat-e Masoumeh University; 2Islamic Azad University Isfahan (Khorasegan) Branch; 3TU Dresden <p>Artificial Intelligence (AI) is swiftly revolutionizing the educational arena, serving as a significant driving force in the improvement of teaching and learning experiences. Despite the increasing interest in the integration of AI in English as a Foreign Language (EFL) instruction, the perceptions of EFL teachers regarding this integration remain underexplored. This study addresses a significant gap in literature by examining EFL teachers’ perceptions of using ChatGPT as an AI-powered chatbot for improving EFL learners’ English language learning. The research employed in-depth interviews with EFL teachers as the primary method for data collection. Analysis of the interview results revealed diverse perspectives regarding the effectiveness of ChatGPT. While some EFL teachers acknowledged its advantages in delivering rapid and precise answers to a variety of inquiries, others voiced concerns that ChatGPT could impede students’ development of critical thinking and research skills, and may inadvertently perpetuate biases or misinformation. Moreover, EFL teachers discussed various ethical considerations associated with the use of ChatGPT in language learning. The obtained findings have some implications for EFL teachers, teacher educators, syllabus designers, and practitioners in EFL contexts for the incorporation of AI within educational settings, especially in the field of English language teaching and learning.</p> |
| 16:45 - 17:00 | Pause |
| 17:00 - 18:00 | Abschluss |
| 18:00 - 21:00 | Get Together Ort: Restaurant Rosengarten Abendevent: Netzwerken in entspannter Atmosphäre |
| Datum: Freitag, 19.09.2025 | |
| 8:45 - 9:00 | Anmeldung Ort: A.106 Anmeldung Chair der Sitzung: Marlen Eisenberg Chair der Sitzung: Alexander Schulze Anmeldung für die GeNeMe-Konferenz |
| 9:00 - 9:15 | Begrüßung Ort: A.104 Seminarraum 1, Fr. ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Thomas Köhler Chair der Sitzung: Prof. Dr. Eric Schoop Chair der Sitzung: Prof. Dr. Ralph Sonntag Chair der Sitzung: Prof. Dr. Silke Geithner |
| 9:15 - 10:15 | Panel innovative Lernorte Ort: A.104 Seminarraum 1, Fr. ZooM-Login Chair der Sitzung: Lea Bachus Die GeNeMe 2025 dreht den Spieß um und holt die Studierenden aufs Podium! Im Panel innovative Lernorte diskutiert Lea Bachus vom Hochschulforum Digitalisierung, selbst Studierende, mit Dresdner Studierenden aus dem Studiengang Weiterbildungsforschung und Organisationsentwicklung welche Erfahrungen sie mit innovativen Lernorten und Lernformaten bisher im Studium gemacht haben – es geht um Makerspaces, digitale Lernplattformen, hybride Räume, selbstorganisierte Lern-Communities. Die GeNeMe 2025 dreht den Spieß um und holt die Studierenden aufs Podium! Im Panel innovative Lernorte diskutiert Lea Bachus vom Hochschulforum Digitalisierung, selbst Studierende, mit Dresdner Studierenden aus dem Studiengang Weiterbildungsforschung und Organisationsentwicklung welche Erfahrungen sie mit innovativen Lernorten und Lernformaten bisher im Studium gemacht haben – es geht um Makerspaces, digitale Lernplattformen, hybride Räume, selbstorganisierte Lern-Communities. |
| 10:15 - 10:30 | Pause |
| 10:30 - 12:00 | Digital Life Ort: A.104 Seminarraum 1, Fr. ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Joachim Niemeier Chair der Sitzung: Sandra Richter Chair der Sitzung: Lisa Gusinde |
|
|
ID: 1119
/ DigLife: 1
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Education Stichworte: Zukunftskompetenzen, Future Working Skills, dual Studierenden [Online] Fit for tomorrow: Future Working Skills in SMEs in Saxony 1Technische Universität Dresden, TUD FaCE, Dresden, Deutschland; 2Universidad Autónoma de Chile, Santiago-Talca-Temuco, Chile; 3Technische Universität Dresden, CODIP-Zentrum, Dresden, Deutschland; 4Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland; 5IU Internationale Hochschule, Dresden, Deutschland Future skills refer directly to those skills and competencies that are likely to be in high demand in the coming years as society and the workplace evolve and adapt to technological advances and the changing economic landscape. Academics and practitioners agree that these skills will enable graduates to meet the challenges of the future in the best possible way (Ehlers, 2020). The authors of this paper wish to present in this article the following aspects: (1) the scientific arguments that support a project about future skills in companies from Saxony (Germany); (2) to present a model and framework of future skills based in the previous works of Ehlers (2020, 2022) and Kotsiou et al. (2022) among others; and (3) the first results of a survey aimed at obtaining current and relevant information and data on future competences/skills and will map trends and needs of various production and service sectors in the Saxony region. ID: 1110
/ DigLife: 2
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life Stichworte: Datensouveränität, Bewerbungsprozess, Verifiable Credential, Wallet, Self-Souvereign-Identity, KI-Agent Bewerber:innen stärken durch datensouveräne, dezentrale Wallets und KI-Agenten 1TU Dresden, Center for Open Digital Innovation and Participation, Deutschland; 2RWTH Aachen, Informatik 5, Deutschland; 3HIS Hochschul-Informations-System eG <p>Bewerbungsprozesse stellen Arbeitssuchende vor ein Dilemma: Sie müssen umfangreiche persönliche Daten preisgeben, verlieren dabei jedoch die Kontrolle über deren Verwendung, Speicherung und Weitergabe. Dies widerspricht dem Prinzip der Datensouveränität, das Individuen das Recht einräumt, selbstbestimmt über ihre eigenen Daten zu verfügen [2]. Darüber hinaus fungieren Bewerberportale als zentralisierte Datensilos, in denen sensible Informationen ohne ausreichende Transparenz oder Nutzerkontrolle verarbeitet werden (können) [7].</p> <p>Unser Vorschlag adressiert die Problematik mangelnder Datensouveränität von Bewerbenden durch die Entwicklung eines dezentralisierten Bewerbungssystems [9], das auf Verifiable Credentials (VC), digitalen (dezentralen) Identitäten (DID) und Self-Souvereign Identity (SSI)-Prinzipien beruht (siehe Abb. 1). Dieses strebt danach, den Inhabern der Daten (holder) Mechanismen an die Hand zu geben, ihre Daten zu schützen. So sollen diese ihre Daten in persönlichen digitalen Wallets verwalten und selektiv mit potenziellen Arbeitgebenden teilen können [2]. Die Integration von KI-basierten Agenten [4] optimiert den Bewerbungsprozess unter Gewährleistung von Datensouveränität. Im Gegensatz zu anderen Verfahren, die bisher auf Seite der Arbeitgebenden ‑ in ihrer Rolle als Datenempfangende und -prüfende (verifier) – ansetzen oder sich auf organisatorische Compliance konzentrieren [7], fokussiert der Ansatz erstmalig die Perspektive der Nutzenden.</p> <p>Das System wird unterstützt durch sechs spezialisierte KI-Agenten:</p> <ol start="1" type="1"> <li>Der <strong>VC-Validator-Agent</strong> verifiziert die Authentizität digitaler Nachweise (z. B. Bildungsabschlüsse, Arbeitszeugnisse) und stellt Konformität mit Standards sicher.</li> <li>Der <strong>GDPR-Compliance-Agent</strong> stellt sicher, dass alle Datenverarbeitungsvorgänge den Anforderungen der DSGVO entsprechen [3, 7].</li> <li>Der <strong>Skills-Matching-Agent</strong> analysiert Kompetenzen aus VCs und Lebensläufen [1, 8] und transformiert diese in standardisierte Taxonomien (z. B. ESCO), um Vergleichbarkeit zu gewährleisten.</li> <li>Der <strong>Redaction-Agent</strong> entfernt kritische persönliche Informationen aus Bewerbungsunterlagen, die für den spezifischen Bewerbungsprozess nicht relevant sind [7, 8].</li> <li>Der <strong>Generation-Agent</strong> adaptiert Lebenslauf und Anschreiben an konkrete Stellenausschreibungen unter Berücksichtigung der freigegebenen VCs.</li> <li>Der <strong>Judge-Agent</strong> überprüft final sowohl die Einhaltung der Datenschutzstandards als auch potenzielle algorithmische Verzerrungen [1, 6].</li> </ol> <p>Dieses System adressiert mehrere aktuelle Herausforderungen: Es minimiert das Risiko algorithmischer Diskriminierung [1, 6], stärkt die Datensouveränität der Bewerbenden und reduziert den Verwaltungsaufwand für Arbeitgebende.</p> <p>Im Rahmen dieses Work-in-Progress-Beitrags werden ausgehend von den Anforderungen der Datensouveränität sowohl die konzeptionelle Architektur als auch erste Überlegungen zur technischen Implementierung vorgestellt und eine Einordung in rechtliche und organisatorische Prozesse [2, 7, 9] vorgenommen.</p> ID: 1142
/ DigLife: 3
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: Ethik, Künstliche Intelligenz, ChatBot, Online Community Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre: Ethische Perspektiven Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland <p>Die fortschreitende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Bildungskontexten transformiert die Hochschullehre grundlegend und wirft zentrale Fragen bezüglich der Rolle der Lehrenden sowie der Gestaltung digitaler Lernräume auf. Auf Grundlage einschlägiger Literatur aus den Bereichen KI, Didaktik, Philosophie und Hochschulforschung untersucht der vorliegende Beitrag sowohl theoretische als auch empirische Perspektiven auf die Chancen und Herausforderungen von KI-Technologien in der universitären Bildung. Besonderes Augenmerk gilt dabei den ethischen Dimensionen des KI-Einsatzes, insbesondere der Frage, wie sich der KI-Einsatz auf die Autonomie der Lernenden auswirkt.</p> <p>Zudem ist eine Umfrage unter Lehrenden, Studierenden und weiteren Hochschulangehörigen geplant, die sowohl deren Wissen über Bias (algorithmische Verzerrungen) und ethische Herausforderungen erfasst als auch ihre Einschätzungen zum Einsatz von KI in der Lehre beleuchtet. Ziel der Befragung ist es, zu ermitteln, inwieweit Lehrende die ethischen Aspekte der Nutzung von KI-gestützten Werkzeugen reflektieren und welche Bedenken und Erwartungen sie dabei haben.</p> <p>Frühere Studien betonen unterschiedliche Aspekte dieses Themenfelds. Chan (2023) problematisiert die ambivalente Rolle von KI als potenziellem Ersatz oder Ergänzung von Lehrenden, wobei einerseits das Risiko eines Verlusts menschlicher Empathie besteht und sich andererseits Chancen für personalisierte, adaptive Lernförderung eröffnen. Chukwuere (2024) hebt die Bedeutung generativer KI-Chatbots als dialogbasierte Werkzeuge hervor, die die Wissensvermittlung und Interaktion in der Hochschulbildung neu gestalten können, und betont die unverzichtbare soziale Verantwortung der Lehrenden in diesem Kontext.</p> <p>Aufbauend auf einem systemischen Ansatz zeigt Katsamakas (2024) die transformative Wirkung von KI auf Hochschulen sowohl als Bildungsinstitutionen als auch als soziale Organisationen auf. Die strategische Implementierung von KI-gestützten Lösungen umfasst dabei sowohl die Automatisierung administrativer Prozesse als auch die Neugestaltung von Lehr- und Lernmethoden. Gleichzeitig offenbaren Befragungen unter Lehrenden ein breites Spektrum an Einstellungen gegenüber dieser Transformation: Einige unterstreichen das Potenzial für individualisierte Lernprozesse, während andere befürchten, dass KI die menschliche Beziehung zwischen Studierenden und Lehrenden beeinträchtigen könnte.</p> <p>Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, welche didaktischen Prinzipien und ethischen Leitlinien für eine verantwortungsvolle Integration von KI in die Hochschullehre entwickelt werden müssen. Durch die Verknüpfung theoretischer Annahmen mit den Perspektiven der Lehrenden soll aufgezeigt werden, wie ein sozialverträglicher Einsatz von KI in der Hochschulbildung im digitalen Zeitalter gestaltet werden kann.</p> ID: 1113
/ DigLife: 4
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Health & Inclusion, Track - Digital Interaction Stichworte: Kulturerbedigitalisierung, Digitale Teilhabe, Community Involvement, Partizipative Forschung [Online] Digitale Teilhabe am Kulturerbe: KI-gestützte Ansätze zur Analyse und Förderung von Kulturerbedigitalisierung ethnischer und kultureller Gemeinschaften Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland Das Horizon-Europe-Projekt DIGICHer adressiert die Digitalisierung des kulturellen Erbes ethnischer und kultureller Gemeinschaften zur Förderung von Gleichberechtigung und Teilhabe. Der Beitrag stellt den aktuellen Entwicklungsstand des darin zu entwickelnden Monitoring-Tools zur Analyse von Förder- und Forschungslandschaften im Bereich der Kulturerbedigitalisierung vor. Eine exemplarische thematische Analyse ausgewählter EU-Projekte der CORDIS-Datenbank eröffnet Einblicke in das Potenzial möglicher Untersuchungen damit. Neben der Darstellung der aktuellen Funktionen der Webanwendung werden geplante Erweiterungen, etwa die Anbindung von weiteren Metadaten, skizziert. Die angeschlossene Befragung erhebt partizipativ Feedback, um das Tool inklusiv weiterzuentwickeln. ID: 1137
/ DigLife: 5
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Interaction Stichworte: Ortsflexibles Arbeiten, organisationale Regeln, Selbstwirksamkeit, Resilienz “Meine Regeln, Deine Regeln? …unsere Regeln!” – eine empirische Untersuchung zum Einfluss der spezifischen Ausgestaltung von Home-Office Regelungen auf Selbstwirksamkeit, Team-Resilienz, Zufriedenheit mit der Leitung und die Gesundheit von Beschäftigten 1Fachhochschule Südwestfalen, Deutschland; 2Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Deutschland <p>Zwei Jahre nach dem offiziellen Ende der COVID-19 Pandemie hat sich das ortsflexible Arbeiten (i e. das Home-Office (HO) als zusätzlicher Arbeitsort) mittlerweile fest etabliert. Aktuelle Daten aus Amerika (Bloom, 2025), Deutschland und Europa (Burke, 2024) zeigen, dass ca. 20-25% der Erwerbsbevölkerung mittlerweile hybrid arbeiten. Diese neue Form der Zusammenarbeit ermöglicht zahlreiche (neue) Gestaltungsoptionen der Kollaboration, die Vor- (z.B. Autonomie) aber auch potentielle Nachteile (z.B. Entgrenzung der Arbeitszeiten) für die Beschäftigten, die Teams und die Unternehmen mit sich bringen (Overbeck-Gurt et al. 2023).</p> <p>Unternehmen stehen hierbei vor der Herausforderung, „passende“ Regelungen zu entwickeln, welche dem neuen hybriden Modell der ortsflexiblen Zusammenarbeit gerecht werden, indem sie potentielle Vorteile ermöglichen, gleichzeitig aber das Auftreten potentieller Nachteile minimieren (Gajendran et al., 2024).</p> <p>Im Rahmen der vorliegenden Querschnittsstudie werden hybrid arbeitende Beschäftigte (n=108) zu den vorliegenden HO-Regelungen in ihrem Unternehmen befragt. Dabei werden die Intensität des HO (Anzahl der Tage pro Woche im HO), die Regelungsebene (Organisation, Team, Führungskraft), die Klarheit & Transparenz (Information) und die Flexibilität von HO-Regelungen erfragt, um deren Relevanz für das Erleben und Verhalten der hybrid arbeitenden Beschäftigten zu überprüfen.</p> <p>Mittels etablierter Skalen auf der individuellen Ebene werden Zusammenhänge zur erlebten Selbstwirksamkeit (Doll et al., 2021) und Gesundheit (Goldberg, 2011) der Beschäftigten untersucht. Auf der kollektiven Ebene werden Bezüge zur Team-Resilienz (Sweetman et al., 2022) analysiert. Die Ergebnisse werden in den aktuellen Forschungsstand eingeordnet und praktische Hinweise für die konkrete Ausgestaltung von HO-Regelungen aus Unternehmens- und Mitarbeitersicht abgeleitet.</p> |
| 10:30 - 12:00 | Digitale Bildung: Kompetenzen Ort: A.103 Seminarraum 2, Fr. ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Kristina Barczik Chair der Sitzung: Niklas Zander |
|
|
ID: 1135
/ DigEd - Comp: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: KI-Kompetenzen, Lehrkräftebildung, Kompetenzentwicklung, Längsschnitt Längsschnittliche Untersuchung zum Einfluss des Besuchs von KI-Kursen auf die Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden 1Universität Leipzig, Deutschland; 2PH Schwäbisch Gmünd, Deutschland <p>Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) spielen nicht nur in der Arbeitswelt eine zunehmend bedeutsame Rolle, sondern verändern auch das Lernen und Unterrichten von Schüler:innen (Zawacki-Richter et al., 2019). Um Lernenden das Lernen mit und über KI pädagogisch-didaktisch sinnvoll nahezubringen, müssen Lehrpersonen selbst KI-Kompetenzen erwerben und befähigt werden, diese bei Schüler:innen zu fördern (Celik et al., 2022). Der Vortrag untersucht die Entwicklung KI-bezogener Kompetenzdispositionen bei angehenden Lehrkräften über ein Semester und bewertet, ob die Teilnahme an KI-bezogenen Kursen diese Dispositionen beeinflusst. Lehramtsstudierende spielen bei der Förderung von KI-Kompetenzen zukünftiger Schüler:innen eine zentrale Rolle (Miao & Cukurova, 2024), doch die Forschung zu KI-bezogenen Kompetenzdispositionen sowie deren Förderung bei Lehramtsstudierenden ist nach wie vor begrenzt (Schmidt, 2024). Aufgrund der Vielzahl an KI-bezogenen Kompetenzen, die angehende Lehrkräfte entwickeln müssen (vgl. AIPaCK-Modell, Lorenz & Romeike, 2023), besteht das Risiko, dass sie nicht ausreichend darauf vorbereitet sind, KI im schulischen Kontext zu unterrichten und einzusetzen.</p> <p>Auf Basis des Kompetenzkontinuum-Modells (Blömeke et al., 2015) und Einstellungsaspekten aus Technologieakzeptanzmodellen (Davis, 1989; Venkatesh & Davis, 2000) analysieren wir Veränderungen im KI bezogenen Wissen, in der intrinsischen Motivation, der Selbstwirksamkeit und in Einstellungen gegenüber KI und KI-Nutzung.</p> <p>Die Stichprobe umfasst <em>N</em> = 265 Lehramtsstudierende zweier deutscher Universitäten, von denen 72 sowohl die Eingangs- als auch die Folgebefragung ausgefüllt haben. Die Ergebnisse zeigen signifikante Zuwächse in der selbst eingeschätzten KI-Kompetenz, der KI-bezogenen Selbstwirksamkeit, positiven Einstellungen und der wahrgenommenen zukünftigen Berufsrelevanz. Teilnehmende, die KI-bezogene Kurse besucht haben, erzielen darüber hinaus zusätzliche Kompetenzgewinne. Die grundlegende KI-Kompetenz und das Interesse an KI bleiben stabil. Zudem zeigt sich, dass sowohl die allgemeine als auch die lehrerspezifische Selbsteinschätzung der KI-Kompetenz im Verlauf des Semesters zunimmt (Zeiteffekt). Die lehrerspezifische KI-Kompetenz hat dann besonders stark zugenommen, wenn die angehenden Lehrkräfte an einem KI-Kurs teilgenommen haben, was einen Interaktionseffekt zwischen Zeitverlauf und Kursbesuch verdeutlicht. Die Ergebnisse unterstreichen den Wert strukturierter Lerngelegenheiten im Bereich KI und sprechen dafür, dass Hochschulen gezielte KI-Kurse für Lehramtsstudierende anbieten sollten, um diese besser auf zukünftige Bildungsherausforderungen vorzubereiten.</p> ID: 1147
/ DigEd - Comp: 2
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: AI Literacy, Corpus Literacy, Critical Media Literacy, Data-driven Learning, secondary education (K-12) Statistisch lesen, kritisch schreiben: Corpus und AI Literacy im Dialog Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg, Deutschland Dieser Beitrag schlägt ein pädagogisches Rahmenkonzept vor, das AI Literacy und Corpus Literacy aus der Perspektive der Kritischen Medienkompetenz miteinander verbindet. Ziel ist es, Lernende mit den interpretativen, analytischen und ethischen Kompetenzen auszustatten, die erforderlich sind, um sich in einer zunehmend durch datengetriebene Technologien geprägten Welt zurechtzufinden. AI Literacy bezeichnet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, sprachbasierte KI-Systeme wie etwa große Sprachmodelle (LLMs) zu verstehen, zu bewerten und mit ihnen zu interagieren. Diese Kompetenz umfasst nicht nur funktionales Wissen – beispielsweise über die Funktionsweise und Potenziale dieser Modelle –, sondern auch eine kritische Bewusstheit über ihre sozio-technischen Grundlagen, einschließlich Fragen nach Verzerrungen (Bias), Intransparenz (Opazität), Autorenschaft und Automatisierung. Demgegenüber konzentriert sich Corpus Literacy auf die Fähigkeiten, Textdatensätze zu erkunden und analytisch zu bearbeiten. Dazu gehören Fertigkeiten wie die Identifikation sprachlicher Muster, das Formulieren empirischer Fragestellungen sowie die kontextbezogene Interpretation datenbasierter Ergebnisse. Obwohl diese beiden Kompetenzen voneinander getrennt erscheinen mögen, sind sie eng miteinander verknüpft: KI-Systeme werden auf Grundlage umfangreicher Textkorpora trainiert, und Korpusanalyse bietet Werkzeuge zur Untersuchung und Validierung KI-generierter Texte. Im Rahmen des Beitrags werden gemeinsame epistemologische Orientierungen beider Literacy-Konzepte hervorgehoben, darunter Mustererkennung, probabilistisches Denken sowie kritische Interpretationsfähigkeit, welche sich im Unterricht gegenseitig verstärken können. Praktische Anwendungen werden anhand konkreter Unterrichtsbeispiele und Lehrstrategien aufgezeigt, die Lernende gleichzeitig als Nutzer:innen und Forschende im Umgang mit KI positionieren. Beispielsweise können Lernende angeleitet werden, KI-generierte Texte als Hypothesen zu behandeln, die mittels korpusbasierter Vergleiche perspektiviert oder überprüft werden – eine Vorgehensweise, die einen rekursiven Dialog zwischen maschinengenerierten Inhalten und empirischer Textanalyse anregt. Durch die Integration dieser beiden Literacy-Bereiche innerhalb eines Rahmens werden Lernende nicht nur dazu befähigt, digitale Technologien kompetent zu nutzen, sondern auch kritische Fähigkeiten zu entwickeln, um algorithmisch generierte Texte interpretieren, hinterfragen und in ihren Kontext einordnen zu können. Solche Lernenden sind besser vorbereitet, die Zuverlässigkeit von Informationen einzuschätzen, die sozio-politischen Dimensionen von KI-Systemen zu verstehen und sich reflektiert an demokratischen sowie wissensgenerierenden Prozessen in einer zunehmend automatisierten Welt zu beteiligen. ID: 1117
/ DigEd - Comp: 3
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: Künstliche Intelligenz, Kompetenzentwicklung, AI Literacy, Stahlindustrie, Erwachsenenbildung [VIDEO] AI4SteelWorkers. Digitale Weiterbildung für KI-Kompetenzen in der Stahlindustrie thyssenkrupp Steel Europe AG, Deutschland Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Kompetenzentwicklung der Belegschaft traditioneller Industriezweige. Das betriebspraktische Projekt "AI4SteelWorkers" adressiert die Forschungsfrage, wie die Kompetenzentwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz in der Stahlindustrie durch zielgruppengerechtes elektronisches Lernen erfolgreich implementiert werden kann. Basierend auf einem sozialkonstruktivistischen Lernansatz wurde ein didaktisches Konzept entwickelt, das fünf Kernelemente umfasst: niedrigschwelliger Zugang, Praxisorientierung mit branchenspezifischen Anwendungsbeispielen, interaktive Lernelemente, multimediale Vermittlung und eine adaptive Lernerfahrung. Die Implementierung erfolgte nicht direktiv, sondern partizipativ. Zunächst wurde eine Informationskampagne durchgeführt, im Anschluss setzt das Projekt auf kollegiale Verbreitung, um die intrinsische Lernmotivation zu nutzen und zu fördern. Die einstündige E-Learning-Einheit vermittelt Grundlagen der KI, branchenspezifische Anwendungsszenarien, praktische Prompt-Engineering-Techniken und fördert die kritische Reflexion von KI-Outputs. Die Evaluation nach dem Kirkpatrick-Modell zeigt, dass innerhalb eines Zeitraums von elf Monaten 1479 Mitarbeitende das freiwillige Angebot in Anspruch nahmen, wobei 61% aus dem gewerblichen Produktionsbereich stammen – einer traditionell schwer erreichbaren Zielgruppe. Die durchschnittliche Zufriedenheitsbewertung liegt bei 4,44 von 5 Punkten (n=215). 64% der Teilnehmenden absolvierten die freiwillige Lernerfolgskontrolle erfolgreich. Es liegen qualitative Beobachtungen von zehn Teilnehmenden vor, die einen Transfererfolg durch konkrete KI-Anwendungen im Arbeitsalltag belegen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Implementierung von KI-Kompetenzen in traditionellen Industrieumgebungen durch die erfolgreiche Anwendung praxisnaher, niedrigschwelliger E-Learning-Angebote, die durch kollegiale Verbreitung unterstützt werden, einen signifikanten Erfolg verspricht. Die hohe Teilnahmequote aus der Produktionsebene veranschaulicht das Potenzial kontextspezifischer Lernangebote. Es bestehen methodische Limitationen in möglichen Selbstselektionseffekten und der begrenzten Repräsentativität der qualitativen Stichprobe. Der gewählte Ansatz bietet ein Transferpotenzial für andere Organisationen, insbesondere im produzierenden Gewerbe, wobei branchenspezifische, kulturelle und organisationale Faktoren zu berücksichtigen sind. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Demokratisierung von KI-Wissen und zum gesellschaftlichen Diskurs über künstliche Intelligenz in traditionellen Arbeitskontexten. ID: 1112
/ DigEd - Comp: 4
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Education Stichworte: KI-bezogene Lehr-Lern-Angebote, Lehrkräftebildung, Berufsbegleitende Qualifizierung [krank] Fachspezifischer Kompetenzaufbau zu Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lehrkräftebildung: Lehr-Lern-Angebote zu KI im Deutschunterricht ZLSB, TU Dresden, Deutschland <p>Künstliche Intelligenz ist bereits in unseren Alltag integriert. Zunehmend wird auch der Aufbau von KI-bezogenen Kompetenzen in Schule und Unterricht gefordert. Um das zu ermöglichen, muss das Thema in der Lehrkräftebildung aufgegriffen und Angebote geschaffen werden. Auf diese neuen Herausforderungen sind Lehrkräfte fachspezifisch vorzubereiten.</p> <p>Der Beitrag präsentiert an zwei Beispielen aus dem Fach Deutsch, wie die Funktionsweise von KI in der Lehrkräftebildung erfahrbar gemacht werden kann und wie diese Angebote fachspezifisch profiliert werden können. Ziel der Lehr-Lern-Angebote ist es, die Teilnehmenden im Seminar für die Potenziale und Herausforderungen im Umgang mit KI zu sensibilisieren und ihnen handlungsnahe Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen, die einen Transfer in Schule und Unterricht ermöglichen.</p> <p>Im ersten Lehr-Lern-Angebot wird mit den Teilnehmenden eine exemplarische Deutschstunde zur Interpretation eines kanonischen Gedichtes für die Sekundarstufe I erprobt. Die Teilnehmenden sind dabei in der Schüler:innenrolle und erleben, wie der auf KI-basierende Chatbot ChatGPT unterrichtlich in die Auseinandersetzung mit einem Gedicht eingebunden werden können. Dazu bearbeiten sie in Kleingruppen zunächst arbeitsteilig verschiedene Analyse- und Interpretationsaufträge und dokumentierten ihre Ergebnisse mithilfe einer digitalen Pinnwand. Anschließend wird ChatGPT mit unterschiedlichen Prompts nach einer Analyse und Interpretation des Gedichts gefragt, um zu eruieren, wie tragfähig die Deutungen des Chatbots sind. Die generierten Antworten werden unter Bezugnahme auf die Befunde der Teilnehmenden kritisch diskutiert, sodass Stärken und Schwächen der KI deutlich werden. Bestimmt wird die abschließende Diskussion von der Frage, wie der Umgang mit KI didaktisch zu rahmen ist.</p> <p>Das zweite Lehr-Lern-Angebot widmet sich dem unterstützenden Einsatz der KI bei der Unterrichtsplanung. Zur Ermittlung der diesbezüglichen Potenziale und Herausforderungen von KI werden KI-generierte Unterrichtsstunden zu zwei exemplarischen Texten des Deutschunterrichts kritisch reflektiert. Die Basis dafür bildet eine zuvor durch die Teilnehmenden vorgenommene didaktische Analyse der Lerngegenstände. Während die unterrichtliche Umsetzbarkeit grundsätzlich plausibel erscheint, zeigen sich Überarbeitungsbedarfe bei der Gegenstandsangemessenheit der Planungsvorschläge, die durch die Lehrkräfte geleistet werden müssen.</p> <p>Der Beitrag bietet Einblicke in zwei fachspezifisch profilierte Lehr-Lern-Angebote zum Aufbau KI-bezogener Kompetenzen in der Lehrkräftebildung. Beschrieben werden die Konzeption der Angebote im multiprofessionellen Team sowie zentrale Beobachtungen zu den Stärken und Schwächen von KI im Deutschunterricht und bei der Planung von Deutschunterricht. Daraus werden in einem Fazit Professionalisierungsbedarfe für eine digitalisierungsbezogene wie fachspezifische Lehrkräftebildung abgeleitet.</p> ID: 1130
/ DigEd - Comp: 5
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Life Stichworte: Digital Literacy, Informed Citizenship, AI, Parental Attitudes Digital Competence, Citizenship, and Parental Attitudes Towards Artificial Intelligence: German Insights Parents International, The Netherlands <p>This study presents findings from the qualitative component of the Erasmus+ Research Project DRONE, which aims to enhance digital literacy and combat disinformation among vulnerable adolescents through a holistic ecosystem approach. It explores the views of 25 parents on digital competence, informed citizenship, and AI in the context of their children’s digital upbringing.</p> <p>Digital Literacy was universally prioritized among all participants. All parents stressed the importance of digital devices, software, platforms, online safety, and critical thinking. Netiquette was frequently mentioned, and over half highlighted the importance of deciding when and how to engage digitally. Some referred to understanding AI as part of digital competence. All invested in their children’s digital literacy and considered their own skills adequate. All had seen fake content; 23 were confident in detecting it. Half noted that context often influences whether content is considered disinformation.</p> <p>On Informed Citizenship, all parents valued staying informed, yet none reported digital literacy education at school. Their main news sources included websites (16), social media (17), TV/radio (13), family (19), friends (14), and newspapers (7), underlying the importance of family as a source of information and its value on digital literacy.</p> <p>Regarding Training and Educational materials most parents reported its informal nature. 23 parents were self-taught in digital literacy and AI, 22 learned from family, and over half from friends. No one was aware of school-based training, underlying the lack of formal training channels for parents but at the same time underlying their importance as educators to their children when see these results in relation to the results regarding inform citizenship.</p> <p>AI Awareness and Knowledge was high. All 25 parents knew about AI, including chatbots (17), translators (19), surveillance tools (14), and social media algorithms (15). All could create strong passwords, 19 used editing tools confidently. Nineteen used AI services regularly. Awareness of data sharing and targeted ads was universal. When in doubt about digital content, 23 consulted friends/family, and 12 asked their children. Interest in new tech varied: 15 high, 5 moderate, 5 low.</p> <p>Perceptions of AI were mixed: 17 said its impact depends on context, 7 saw it as minor, and 3 as significant. Concerns included job loss (14), data misuse (9), and fear of the unknown (17). Benefits included task ease (24), learning support (11), content creation (10), and work use (12). Common uses were translation (18), homework (7), and content production (12).</p> |
| 12:00 - 13:00 | Mittagspause |
| 13:00 - 14:30 | Digitale Gesundheit & Inklusion Ort: A.104 Seminarraum 1, Fr. ZooM-Login Chair der Sitzung: Dr. Sandra Schulz Chair der Sitzung: Stefanie Mikolai |
|
|
ID: 1145
/ DigHI: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Health & Inclusion Stichworte: Digitalisierung im Gesundheitswesen, Elektronische Patientenakte, ePA, Akzeptanz, Technologieakzeptanzmodell, Digitale Gesundheitskompetenzen, EHealth Akzeptanz der elektronischen Patientenakte (ePA) und Implikationen zur Erhöhung der Nutzungsbereitschaft – Ergebnisse einer quantitativen Studie in Aachen-Burtscheid University of Applied Science CBS mit EUIFH, Deutschland <p>Die pseudoanonymisierte Bereitstellung der Gesundheitsinformationen aus der elektronischen Patientenakte (ePA) steigert die Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland immens. Im Zuge einer flächendeckenden Nutzung der ePA lassen sich deutlich mehr medizinische Daten erheben, die Rückschlüsse für ganzheitliche Therapien, Pflegeansätze und für die Gesundheitsberichterstattung, aber auch die Forschung bieten (Haug et al. 2024). Allerdings ist die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems, insbesondere was die Einführung der ePA betrifft, im europäischen Vergleich marginal. Während andere europäische Länder langjährig und erfolgreich die Implementierung einer ePA abgeschlossen haben, kann in Deutschland - weder auf Seiten der Leistungserbringer noch auf Seiten der Nutzenden – eine Durchdringung festgestellt werden. Ursächlich für die Leistungserbringer sind fehlende Informationen bezüglich der Nutzungsmöglichkeiten und dem Mehrwert der ePA, was wiederum die Bereitschaft zur Einführung und Nutzung dieser, insbesondere im hausärztlichen Setting mindert (Konopik et al. 2024; Urbanek 2022). Umfängliche Prozesse, die für Datenschutz und -umgang erforderlich sind, verzögern den Einführungsprozess. Möglicherweise stellen fehlende digitale Gesundheitskompetenzen einen weiteren Erklärungsansatz dar (Schaeffer et al. 2021; Schaeffer & Gille 2022). Auf Seiten der anvisierten Nutzenden der ePA ist die Datenlage gegenwärtig zu gering, um Ursachen für die Zurückhaltung zu eruieren.</p> <p>Der Beitrag setzt an diesem Desiderat an und nähert sich auf Basis des Technologieakzeptanzmodells von Davis (1986) der Exploration von Faktoren, die auf die Verhaltensabsicht und Adaption der ePA einen Einfluss besitzen. Hierfür wurde eine quantitative Fragebogenerhebung (n = 102) im Stadtteil Aachen-Burtscheid aus dem Jahr 2024 realisiert, um den Einfluss der Faktoren Alter, Digitalkompetenz, digitale Gesundheitskompetenz, wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit, Bedenken, Outputqualität und Persönlichkeitsfaktoren herauszuarbeiten. Auf Basis von statistischen Analysen lässt sich im Ergebnis feststellen, dass die Nutzung der elektronischen Patientenakte im Stadtteil Aachen–Burtscheid zum aktuellen Zeitpunkt gering ausgeprägt ist. Demgegenüber ist ein positiver Trend bei der Nutzungsabsicht der ePA zu verzeichnen. Die Nutzungsabsicht wird primär durch die Bedenken bei der Nutzung und durch die erkannte Outputqualität beeinflusst. Ebenfalls konnte ein geringer Zusammenhang zu den Faktoren „Digitalkompetenz“, „Unterstützungsbedarf“, „Selbstwirksamkeit“ und „wahrgenommenen Nützlichkeit“ und „Benutzerfreundlichkeit“ festgestellt werden. An diesen Punkten anknüpfend, können Handlungsempfehlungen für Krankenkassen abgeleitet werden, um die Transformation der ePA zu beschleunigen.</p> ID: 1118
/ DigHI: 2
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education, Track - Digital Health & Inclusion, Track - Digital Interaction Stichworte: Inklusive Hochschulbildung, Assistenzsysteme, Barrierefreiheit, Augmented Reality, Implementierung Barrierearme Hochschullehre mit informationstechnischen Assistenzsystemen – Entwicklung des Implementierungsmodell INARE für Augmented Reality 1Hochschule Zittau/Görlitz, Deutschland; 2Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland Barrierearme Hochschullehre ist ein zentrales Ziel der digitalen Transformation. Trotz vielversprechender informationstechnischer Assistenzsysteme bleibt das Potenzial von Augmented Reality (AR) zur Kompensation von Behinderungen weitgehend ungenutzt. Unser Beitrag stellt das INARE-Modell (INclusive Augmented Reality for Education) vor. Dabei handelt es sich um einen systematischen, phasenorientierten Leitfaden zur barrierearmen Implementierung von AR über Head-Mounted Displays (HMD) in der Hochschullehre. Methodisch kombiniert INARE eine qualitative Expert*innenbefragung mit einer systematischen Literaturrecherche. Die Befragung fand in Form eines moderierten Workshops statt, in dem die Teilnehmenden AR-Anwendungen selbst ausprobierten und in Gruppen diskutierten. Die Literaturanalyse folgte den PRISMA-Richtlinien und identifizierte Kernstudien zur AR-Implementierung. Die Ergebnisse der Befragung und der Literaturrecherche zeigen, dass AR in der Hochschullehre bislang selten didaktisch fundiert oder inklusiv konzipiert wird. Es besteht Konsens darüber, dass eine multisensorische Unterstützung – beispielsweise visuelle AR-Inhalte, die um Audiosignale und haptisches Feedback ergänzt werden – unerlässlich ist, um Studierende mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen aktiv einzubinden. Zudem erfordert die Entwicklung solcher Anwendungen eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Softwareentwickler*innen. Auf Basis dieser Erkenntnisse definiert INARE sechs Phasen: Analyse, Design, Entwicklung, Implementierung, Evaluation und Skalierung sowie vier Handlungsbausteine: Organisation, Didaktik, Inklusion und Technologie. Die Limitationen betreffen die geringe Stichprobe der Expert*innenbefragung, die Beschränkung auf HMD-Systeme und die fehlende direkte Einbindung von Menschen mit Behinderungen. Die Literaturrecherche ist zudem auf den Zeitraum 2020–2025 und englischsprachige Quellen begrenzt. Als Ausblick empfehlen die Autor*innen, dass zukünftige Forschung das INARE-Modell partizipativ mit Betroffenen weiterentwickeln, in disziplinübergreifenden Studien validieren und um kostengünstige AR-Plattformen erweitern sollte. Sie laden die Hochschul-Community ein, das INARE-Modell kritisch zu prüfen, weiterzuentwickeln und damit AR als inklusives informationstechnisches Assistenzsystem allen Studierenden zugänglich zu machen. ID: 1159
/ DigHI: 3
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Health & Inclusion, Track - Digital City Stichworte: Digitale Teilhabe Mittler*in Informelles Lernen Typenbildung Ältere Erwachsene [Online] Typisierung von Mittler*innen: Förderung digitaler Teilhabe in Kontexten informellen Lernens älterer Erwachsener 1Katholische Hochschule NRW (katho), Deutschland; 2Bildungszentrum Universitätsklinikum Düsseldorf <p>Digitalisierung und Digitalität (Hauck-Thum & Noller, 2021; Stalder, 2021) durchziehen und verändern alle Lebensbereiche. Es entstehen Netzwerke aus menschlichen und nicht-menschlichen Komponenten (Kerres, 2023) und multiple Möglichkeiten digitaler Teilhabe (Ehlers et al., 2020). Gleichzeitig können digitalisierungsbezogene Veränderungen Teilhabe beeinträchtigen. Beispiel hierfür sind die Digitalisierung analoger Verfahren (Ticketkauf) und die Verpflichtung zum Schutz eigener Daten durch User*innen. Aus den Möglichkeiten der Digitalisierung werden alternativlose Anforderungen (Barczik et al., 2021; Reissmann et al., 2022). Die digitale Transformation stellt besonders ältere Erwachsene vor Herausforderungen und kann sich durch unreflektierte Nutzung oder Ablehnung von Anwendungen auf die individuellen Teilhabechancen auswirken (Initiative D21 e. V., 2024).</p> <p>Im Zusammenhang mit der Förderung digitalisierungsbezogener Teilhabe Älterer nehmen freiwillige Mittler*innen, die Angebote zum Umgang mit digitalisierungsbezogenen Anforderungen bereitstellen, eine bedeutende Rolle ein (Barczik et al., 2021; Doh et al., 2021; Stiel et al., 2018). Neben diesen aufsuchenden Optionen erhalten ältere Erwachsene auch Unterstützung direkt in ihrer Lebenswelt durch Angehörige oder beruflich Pflegende (Hölterhof et al., 2025 (in Print); Thalhammer, 2018). Beide agieren als ‚warm experts‘ und unterstützen bei technischen Fragestellungen, leiten gezielt an oder übernehmen Handlungen (Bakardjieva, 2005; Geerts et al., 2023).</p> <p>Obgleich deutlich wird, dass unterschiedliche Arten von Mittler*innen für digitalisierungsbezogene Unterstützung existieren, fehlen differenzierte Betrachtungen dieser verschiedenen Typen, ihrer Vorstellungen vom Mittler*in-Sein und Handlungsmuster.</p> <p>Das BMBF-Projekt CrossComITS setzt hier an und untersucht die Befähigung zur digitalen Teilhabe von vulnerablen Gruppen in Bezug auf IT-Sicherheit. Auf Basis einer qualitativen Analyse (Kuckartz & Rädiker, 2024) von leitfadengestützten Interviews mit unterschiedlichen Mittler`*innen (freiwillig Engagierte, beruflich Pflegende) sowie der ergänzenden Perspektiven von Kursteilnehmenden aus Workshops zu Themen der IT-Sicherheit wird eine qualitative Typisierung (Kelle & Kluge, 2010) von Mittler*innen für das informelle digitalisierungsbezogene Lernen älterer Erwachsener durchgeführt. Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen.</p> <p>Eine Typisierung kann dabei unterstützen, die Bedeutung des Mittler*in-Seins zu reflektieren und Ansatzpunkte für die Gestaltung passgenauer Unterstützungsangebote für ältere Menschen sowohl im freiwilligen Engagement als auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung Pflegender bieten und einen wichtigen Beitrag zur Förderung der digitalen Teilhabe älterer Menschen leisten. In weiterer Forschung könnten die Wechselwirkungen zwischen Mittler*innen-Typen und Lernerfolgen älterer Erwachsener untersucht und Empfehlungen für Politik, Bildungsträger und Communities abgeleitet werden.</p> ID: 1126
/ DigHI: 4
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Health & Inclusion Stichworte: organisationale Resilienz, digitale Risiken, Digitalisierung, Gesundheitsorganisationen, digitale Resilienz Digitale Resilienz: Herausforderung und Notwendigkeit in Gesundheitsorganisationen 1Evangelische Hochschule Dresden [EHS], Deutschland; 2Technische Universität Chemnitz, Deutschland <p>Jüngste Krisen im Gesundheitswesen wie die COVID-19-Pandemie haben die Schwächen der Gesundheitsversorgungssysteme deutlich gemacht (Hack-Poley et al. 2023; Cobianchi et al. 2020). Technologische Innovationen können dabei eine zentrale Bedeutung für die Weiterentwicklung von Gesundheitsorganisationen darstellen (Hack-Poley et al. 2023). So kann z.B. der Einsatz digitaler Technologien – etwa die elektronische Patientenakte – nachweislich Effizienz und Versorgungsqualität verbessern (Pool et al. 2024; Chandwani et al. 2018; Kohli & Tan 2016; Stephanie & Sharma 2020).</p> <p>Gleichzeitig bringt die Digitalisierung erhebliche Risiken mit sich. Gesundheitsorganisationen sind besonders anfällig für Datenschutzverletzungen und Cyberangriffe wie Phishing, Malware oder Ransomware (Pool et al. 2024; Gordon et al. 2017; Tab. 1). Solche Angriffe gefährden nicht nur die Daten- und Versorgungssicherheit, sondern können auch direkte gesundheitliche Schäden bei Patient:innen verursachen, etwa durch Angriffe auf medizinische Geräte (Halperin et al. 2008; Li et al. 2011). Damit wird die Cybersicherheit im Gesundheitswesen zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema (Liu et al. 2022; Tab. 2).</p> <p>In Anbetracht divers auftretenden digitalen Risiken, ist <strong>Resilienz</strong> als die Fähigkeit von Organisationen, Krisen und Veränderungen vorherzusehen, zu bewältigen und daraus zu lernen, von enormer Bedeutung (Duchek 2020; Hepfer & Lawrence 2022). Organisationale Resilienz umfasst 3 Phasen:</p> <ol start="1" type="1"> <li><strong>Antizipation</strong> (vor dem Ereignis),</li> <li><strong>Bewältigung</strong> (während des Ereignisses) und</li> <li><strong>Anpassung</strong> (nach dem Ereignis).</li> </ol> <p>Im Zeitalter der Digitalisierung, in der der Einsatz von Daten und algorithmischen Systemen für neue Prozesse und Geschäftsmodelle eine Konstante ist (BMWK (2024), ist für die Resilienz von Organisationen insgesamt insbesondere ihre digitale von zentraler Bedeutung. <strong>Digitale Resilienz </strong>beschreibt im Gesundheitswesen die Fähigkeit, digitale Risiken (z. B. durch Stromausfälle, KI-Einsatz) frühzeitig zu erkennen, im Ernstfall wirksam zu reagieren und aus Vorfällen zu lernen (Abb. 1).</p> <p>Da in Deutschland bislang unklar ist, wie (1) eine langfristig stabile Nutzung digitaler Technologien –im komplexen System Krankenhaus sichergestellt werden kann, und (2) wie technologische Risiken wie Datenmissbrauch oder der Ausfall medizinischer Infrastruktur die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von Krankenhäusern und ihren Akteur:innen beeinflussen, untersucht das Forschungsprojekt „Digitale Resilienz von Krankenhäusern in Sachsen“ (DiReK), das im September 2023 startete und gemeinsam von der TU Chemnitz und der ehs Dresden durchgeführt wird, wie sächsische Gesundheitsdienstleister mit digitalen Risiken umgehen, und wie sich dies auf ihre organisationale Resilienz auswirkt. Grundlage bildet eine quantitative Befragung der Krankenhäuser in Sachsen, und darauf aufbauend Fallstudien.</p> |
| 13:00 - 14:30 | Digital Education: AI Ort: A.103 Seminarraum 2, Fr. ZooM-Login Chair der Sitzung: Dr. Sandra Hummel Chair der Sitzung: Lisa Gusinde |
|
|
ID: 1114
/ DigEd - KI: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: Adaptive Lernumgebungen, Formatives Feedback, Instruktionsdesign, Künstliche Intelligenz Instruktionsdesign und Künstliche Intelligenz in Lernumgebungen: Entwicklung eines kompetenz- und outputvaliden adaptiven Feedbacksystems in der Hochschulbildung TU Dresden, Deutschland <p><em>Die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in Bildungsumgebungen gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Kontext adaptiver und personalisierter Learning Management Systeme (LMS). Viele derzeit eingesetzte KI-Lösungen – etwa ChatGPT und vergleichbare Large Language Models – operieren auf der Basis offenen Weltwissens, sind jedoch nicht an spezifische Lehrinhalte, Lernziele oder Kompetenzmodelle angebunden. Dies führt häufig zu kognitiver Überlastung und einem Rückgang der Lernmotivation, da das generierte Feedback weder lehrstoff- noch lernzielvalide ist.</em></p> <p><em>Der vorliegende Beitrag präsentiert eine Post-Studie, die auf einer bereits publizierten Pre-Test- und Primäruntersuchung mit 400 Studierenden an der Universität Leipzig und der TU Dresden aufbaut. Ziel der aktuellen Untersuchung ist die vertiefte Evaluation eines KI-basierten, formativen Feedbacksystems, das systematisch an curriculare Vorgaben, konkrete Lernziele und Aufgabenstellungen angebunden ist. Im Gegensatz zu generischen Sprachmodellen basiert das eingesetzte System auf einem instruktionsfundierten, selbsttrainierten Large Language Model, das auf validierten Lehrmaterialien, Aufgabenformaten sowie den zugehörigen Lehr- und Lernzielen operiert und daraus adaptive Rückmeldungen generiert. Ziel ist es, kognitive Belastung zu reduzieren, Lernprozesse zu individualisieren und die Zielerreichung im Hochschulkontext zu optimieren.</em></p> <p><em>Im Rahmen des Post-Tests im Wintersemester 2024/25 nahmen 100 Studierende der TU Dresden teil, die in Lehrveranstaltungen wie „Bildungstechnologie“ und „Medienbildung“ eingeschrieben waren. Über den Verlauf des Semesters wurden rund 400 studentische Abgaben mithilfe des KI-Systems individuell kommentiert. Die Teilnehmenden konnten ihre Einreichungen freiwillig mehrfach überarbeiten und erneut einreichen. Das Feedback passte sich dynamisch an den individuellen Lernfortschritt an und enthielt sowohl Hinweise auf nicht erreichte Lernziele als auch konkrete Verbesserungsvorschläge. Sämtliche Interaktionen wurden systematisch im LMS dokumentiert.</em></p> <p><em>Zur Überprüfung der Wirksamkeit des KI-Feedbacksystems in Bezug auf den Lernoutput wurde ein einseitiger, abhängiger t-Test durchgeführt, um folgende Hypothese zu prüfen: Erhöht sich die Anzahl der erreichten Lernziele signifikant nach der Feedback-Intervention? Die Ergebnisse zeigen, dass ein curricular integriertes KI-Feedbacksystem das adaptive Lernen signifikant fördert – insbesondere im Hinblick auf den Kompetenzerwerb, die Erreichung definierter Lernziele sowie die Leistungsmotivation der Lernenden im Sinne der Erwartung-mal-Wert-Theorie (Heckhausen, 2010). Die Befunde verdeutlichen die Relevanz didaktisch fundierter KI-Systeme, die gezielt auf lehrzielbezogenes Feedback und nachhaltige Lernprozesse ausgerichtet sind.</em></p> ID: 1134
/ DigEd - KI: 2
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education Stichworte: Hochschullehre, Lernstrategien, KI-Feedback, Aufgabengenerieren Wenn Studierende Aufgaben erstellen und KI dazu formatives Feedback erzeugt: Ein Modell für die universitäre Lehrpraxis? TU Dresden, Deutschland <p>Aktuelle Studien zeigen, dass das Beantworten, selbständige Generieren, aber auch das Beurteilen der Qualität von Aufgaben zu den effizientesten Strategien zur Förderung langfristigen Wissenserwerbs zählt (u.a. Ebersbach et al. 2020). Besonders wirksam sind dabei Aufgaben, die tiefes Verstehen erfordern (Fiorella, 2023). Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse erstellen Teilnehmende in einer universitären Lehrveranstaltung als Studienleistung für jede Vorlesung eine Verstehensaufgabe, beantworten eine Verstehensaufgabe anderer Studierender und verfassen Peer-Feedback zur beantworteten Aufgabe. Anhand des Peer-Feedbacks haben die Studierenden im Anschluss die Möglichkeit, ihre generierten Aufgaben zu überarbeiten. Dadurch wird ihnen eine über das Semester verteilte, lernunterstützende formative Analyse, Einschätzung und Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen ermöglicht (Narciss & Zumbach, 2022). Darüber hinaus reduziert diese verteilte Auseinandersetzung nicht nur die traditionell hohe Prüfungslast am Ende der Vorlesungszeit, sondern setzt gleichzeitig zwei besonders effiziente Lernstrategien – <em>practice testing </em>und <em>distributed practice</em> – gezielt um, die langfristig mit höherem Lernerfolg einhergehen (u.a. Dunlosky & Rawson, 2015).</p> <p>Ziel dieses Pilotprojektes ist es zu untersuchen, ob Feedback eines KI-Systems zu den generierten Aufgaben über die Reviews der Peers hinaus einen inhaltlichen Mehrwert für die Studierenden bieten kann. Peer-Feedback konzentriert sich oft eher auf positive Aspekte und geht nicht so deutlich auf negative Aspekte ein. Im Gegensatz dazu bieten Experten oft ausgewogeneres Feedback an, das gleichzeitig auch Informationen zur Verbesserung bestimmter Aspekte liefert (Weber et al., 2019). Jacobson und Weber (2023) konnten bereits zeigen, dass KI-generiertes Feedback vergleichbar mit Expertenfeedback sein kann, wenn eine hohe Qualität der verwendeten Prompts sichergestellt ist. Im Rahmen eines Pilotprojekts werden daher solche qualitativ hochwertigen Prompts entwickelt. Für zwei ausgewählte Vorlesungen werden diese Prompts über ein KI-gestütztes System eingesetzt, um unter Nutzung der Vorlesungsfolien automatisiert konstruktives Feedback zu den von den Studierenden generierten Aufgaben bereitzustellen. Im Anschluss wird das KI-generierte Feedback inhaltlich mit dem Peer-Feedback der Studierenden sowie einem Expertenreview zur Qualität der Aufgaben verglichen. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Analyse mit Studierenden im Hinblick auf Vor- und Nachteile der verschiedenen Review-Methoden reflektiert. Wenn das Pilotprojekt einen Mehrwert des KI-generierten Feedbacks zeigt, könnten Studierende in weiteren Lehrveranstaltungen selbst KI-generiertes Feedback zu ihren Verstehensaufgaben einholen, um diese zusätzliche Informationsquelle für die Überarbeitung ihrer Aufgaben zu nutzen. Die Prompts könnten je nach Lehrziel direkt nachgenutzt oder fachspezifisch angepasst werden, wodurch eine fächerübergreifende Nutzung möglich wird.</p> ID: 1104
/ DigEd - KI: 3
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education Stichworte: Prompting, Arbeitsbezogenes Lernen, AI Literacy, Intervention, Workshop Evaluation einer Trainingsintervention zur Förderung des arbeitsbezogenen Lernens bei der Nutzung von KI-basierten Chat-Anwendungen Universität Bremen, Deutschland <p>Die Entwicklung von KI-basierten Chat-Anwendungen wie Microsoft Copilot revolutioniert die Art und Weise, wie wir lernen und arbeiten (Dai et al., 2023; Decius, 2024), indem sie individualisiertes, begleitetes Lernen sowohl in der Bildung als auch im Arbeitskontext ermöglichen (Krüger et al., 2024; Zhai et al., 2022). Studien zeigen jedoch, dass die Ergebnisse und die Effektivität solcher Anwendungen abhängig sind vom Nutzungsverhalten, insbesondere der Prompts (Sawalha et al., 2024).<br />Deshalb wurde ein Workshop zur Vermittlung von Prompting-Strategien entwickelt und evaluiert. Dabei stehen zwei Forschungsfragen im Fokus:</p> <p>1. Wie effektiv ist ein Workshop zur Vermittlung von Prompting-Strategien in Hinblick auf den Lernerfolg während die Nutzung von Copilot?</p> <p>2. Wie wirkt sich die Anwendung der Prompting-Strategien auf den Lerntransfer aus?</p> <p>Die Struktur des Workshops basiert auf dem 5E-Modell (National Science Board, 2008), welches insbesondere für die Vermittlung von MINT-Inhalten geeignet ist. Das Modell unterteilt den Workshop in fünf Phasen – Engagement, Exploration, Erklärung, Elaboration, Evaluation – mit unterschiedlichen inhaltlichen und methodischen Schwerpunkten und bietet den Lernenden so die Möglichkeit, anhand vieler interaktiver Bausteine die Lerninhalte selbst anzuwenden und zu verinnerlichen. Der Workshop ist zudem darauf ausgelegt, sowohl das Performance Mindset, also die Leistungsmotivation beim Bearbeiten einer Aufgabe, als auch das Development Mindset, also die Lern- und Weiterentwicklungsmotivation nach Perkins et al. (2013) anzusprechen und somit auch Nutzungsstrategien zur persönlichen Weiterentwicklung zu vermitteln.</p> <p>Die Evaluation erfolgt durch ein Wartekontrollgruppendesign mit wiederholten Messungen, wie in Abbildung 1 dargestellt, wobei der Lernerfolg quantitativ durch Wissenstests und Selbstauskünfte sowie qualitativ durch Interviews erhoben wird.</p> <p>Hierbei werden zwei Zielgruppen betrachtet: Zum einen wird der Workshop im Kontext einer beruflichen Ausbildung evaluiert, wodurch kaufmännische und technische Auszubildende die erste Zielgruppe ausmachen. Die zweite Zielgruppe besteht aus Angestellten verschiedener Unternehmen, die bereits über eine abgeschlossene Berufsqualifizierung sowie einschlägige Berufserfahrung verfügen.</p> <p>Abb. 1: Evaluationsdesign</p> <p>Erste Ergebnisse zeigen, dass der Workshop ein geeigneter Start in das Thema „Prompting“ ist, je nach Zielgruppe allerdings eine längerfristige Implementationsphase nützlich wäre. Die Evaluation wird zum Zeitpunkt der Konferenz bei mindestens zwei Partnerunternehmen abgeschlossen sein, sodass Ergebnisse über mehrere Zielgruppen hinweg präsentiert werden können.</p> ID: 1129
/ DigEd - KI: 4
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education Stichworte: KI, Lernmanagementsysteme, pädagogische Implikationen, technologische Machbarkeit, regulatorische Anforderungen Entwicklung eines Bewertungsschemas für KI-Funktionalitäten in Lernmanagementsystemen 1Universität Innsbruck, Österreich; 2Universität Graz, Österreich <p>Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Lernmanagementsysteme (LMS) wie beispielsweise Moodle, OpenOlat, Ilias oder Canvas nimmt stetig zu. Diese Entwicklung wirft zentrale Fragen hinsichtlich der Art der eingesetzten KI-Technologien und ihrer jeweiligen Funktionen auf. Dabei ist zu klären, ob deren Implementierung primär durch pädagogische Erkenntnisse oder durch technologische und marktgetriebene Innovationen motiviert ist. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit diese Systeme den europäischen Regularien, insbesondere den Vorgaben des AI Act und der DSGVO, entsprechen. Theoretische Ansätze zum didaktisch motivierten KI-Einsatz finden sich mittlerweile in zahlreichen Publikationen (Deroncele-Acosta et al., 2024), (Кazimova et al., 2025), eine umfangreiche kritische Bewertung von bisher tatsächlich implementierten KI-gestützten Funktionen in LMS fehlt jedoch bislang.</p> <p>Konzepte zur Steigerung der Bildungsqualität und der Lernergebnisse durch den KI-Einsatz in LMS sind umfangreich dokumentiert. Dabei werden insbesondere personalisiertes und adaptives Lernen (Ikhsan et al., 2025), (Roodsari & Köhler, 2025), intelligente Tutorensysteme (Mimoudi, 2024), datengestützte Entscheidungsfindungen (z.B. in Form von Learning Analytics) (N. S. Alotaibi, 2024) und (teil)automatisierte Bewertungen im Rahmen der Leistungsbeurteilungen (Hudiah et al., 2024) genannt. Positive Lerneffekte ergeben sich generell auch aus der automatisierten Erstellung von Untertiteln (H. M. Alotaibi et al., 2023) oder der KI-Unterstützung bei Textformulierungen (Meyer & Weßels, 2023).</p> <p>Trotz dieser Potenziale bleibt unklar, in welchem Maß die aktuelle Integration von KI in LMS tatsächlich den gewünschten pädagogischen Nutzen bietet. Neben didaktischen Überlegungen und der technischen Machbarkeit sind auch rechtliche und ethische Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere in Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten von Lernenden und Lehrenden, auf das Urheberrecht und auf die Wahrung der akademischen Integrität. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass KI-gestützte Funktionen ohne fundierte didaktische Konzepte eingeführt werden und somit bestehende Lehr-/Lernprozesse nicht sinnvoll ergänzen, sondern möglicherweise sogar beeinträchtigen.</p> <p>Die Entscheidungshoheit über den Einsatz von KI innerhalb von LMS sollte nicht ausschließlich bei Drittanbietern liegen, sondern maßgeblich durch hochschulinterne Prozesse mitgestaltet werden. In diesem Kontext ist eine strukturierte Bewertungsmethode erforderlich, um fundiert zu entscheiden, welche KI-Anwendungen an welchen Stellen eines hochschuleigenen LMS sinnvoll integriert werden sollten. Im Beitrag wird daher eine – bestenfalls bereits in der Praxis getestete – Struktur vorgeschlagen, die es Hochschulen ermöglicht, den Einsatz von KI innerhalb ihrer digitalen Lernumgebungen reflektiert zu analysieren und bedarfsgerecht zu steuern.</p> |
| 14:30 - 14:45 | Pause |
| 14:45 - 15:00 | Abschluss Ort: A.104 Seminarraum 1, Do. ZooM-Login Chair der Sitzung: Prof. Dr. Thomas Köhler Chair der Sitzung: Prof. Dr. Eric Schoop Chair der Sitzung: Prof. Dr. Ralph Sonntag Chair der Sitzung: Prof. Dr. Silke Geithner |