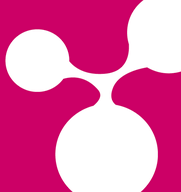GeNeMe 2025
Gemeinschaften in Neuen Medien
17. - 19. September 2025 in Dresden
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Sitzung | ||
Digitale Interaktion: KI
| ||
| Präsentationen | ||
ID: 1127
/ DigIn - KI: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: Smart Learning Experiences, KI-gestützte Lernarrangements, Interaktionsanalyse act4teams, Didaktisches Sechseck KI-gestützter Interaktionen Verlieren wir nun endgültig das Miteinander? - KI-gestützte Lernsituationen aus der Sicht der Interaktions- und Kommunikationsforschung TU Dresden, Deutschland <p>Die moderne KI-Forschungsoffensive, insbesondere im Bildungsbereich, fördert die Integration neuer KI-Strategien in etablierte Sozialstrukturen, da der Umgang mit Künstlicher Intelligenz entscheidend für die berufliche Kompetenzentwicklung ist [1,2,3]. Dies wird jedoch oft durch die Skepsis gegenüber generativen KI-Tools, die als Bedrohung für zwischenmenschliche Interaktionen wahrgenommen werden, gehindert [4,5,6]. Doch wie lässt sich diese Aversion zielführend in die bildungswissenschaftliche Forschung einbinden?</p> <p>Der vorliegende Beitrag analysiert KI-gestützte Gruppendynamiken quasi-experimentell in beruflichen Lernsituationen, diskutiert diese aus der Perspektive beruflicher Interaktionsforschung und synthetisiert die Erkenntnisse in einem Modell KI-gestützter Interaktionen.</p> <p>Hybride soziale Interaktionen zwischen menschlichen und algorithmischen Akteuren – beispielsweise Computervermittelte Kommunikation (CMK) und KI-gestützte Kommunikation (KIGK) [10,11] – haben einen besonderen Stellenwert in den Sozialstrukturen der Digitalität [13,18,21,22]. Das Konzept der Smart Learning Experiences (SLXs), siehe Abb. 1, hat daher zum Ziel, die digitale Partizipationskompetenz (DPK) zu entwickeln [8, 12]. Dieses pädagogische Planungs- und Reflexionskonzept modifiziert daher bestehende Modelle der Didaktik [7] und Kompetenzentwicklung [1,2] für die Schulbildung.</p> <p>Zur statistischen Erkundung solcher KIGK im Rahmen der Smart Learning Experiences, wird eine auf dem SLXs-Konzept basierte KI-gestützte Lernsituation (Abb. 2) im Sektor der (bau-)technischen Berufsausbildung quasi-experimentell untersucht. Die darin stattfindende Team-KIGK wird mittels der act4team-Interaktionsanalyse [20, 23] beobachtet, protokolliert und deskriptiv ausgewertet.</p> <p>Die skizzierten Mittelwerte erhobener Daten (Abb. 3) zeugen von einer Zielgerichtetheit und Zweckmäßigkeit KI-gestützter Kommunikation, ähnlich den Ergebnissen beruflicher Interaktionsforschung [9,10,12,13]. Die identifizierte Zirkularität der KIGK spiegelt sich in der Fluidität der Interaktionskategorien wider und folgt ebenso Befunden, die grundlegende Prinzipien der Kommunikation auf CMK und KIGK ausweiten [16]. Die protokollierte Komplexität der KIKG stellt besondere Bewältigungsmechanismen der Digitalität dar [17,14]: Räumliche und zeitliche Asynchronität, erweiterte Konvergenzen und Personalisierungsmodalitäten lassen sich in Ergebnissen anderer Interaktionsstudien wiederfinden [14,15,21].</p> <p>Daraus ergibt sich eine klare Verneinung der Titelfrage und damit eine Notwendigkeit, die Aversion gegenüber disruptiven Einflüssen von KI-Technologien proaktiv aufzugreifen. Eine Lösung bietet das entwickelte Modell „Didaktisches Sechseck KI-gestützter Interaktionen“ (Abb. 3). Es dient als eine Entwicklungsstufe zwischen den konventionellen didaktischen Interaktionsmodellen [19] und dem AIMC-Modell unabhängiger beruflicher KI-Umgebungen [16] und koppelt so das „disruptive Unbekannte“ mit bekannten Interaktionsstrukturen.</p> ID: 1139
/ DigIn - KI: 2
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education Stichworte: Instructional Design, Mensch-KI-Interaktion, Selbstgesteuertes Lernen Prompt, Prozess und Person. Anwendungspraktische Erkenntnisse für den reflektierten Einsatz von KI im Instruktiondesign Technische Hochschule Lübeck, Deutschland <p>Instruktionsdesign ist ein komplexer, technologieaffiner und reflexionsorientierter Prozess, der die didaktische Konzeption, Medienproduktion und technische Implementierung digitaler Lehr-Lern-Arrangements umfasst – und daher vom transformativen Wandel durch KI besonders betroffen ist. Der Einsatz von KI-Werkzeugen verändert nicht nur, was getan wird, sondern vor allem, wie es getan wird. Im Mittelpunkt des Beitrags steht daher die Frage, wie die Integration KI-gestützter Werkzeuge den Instruktionsdesign-Prozess und die Rolle der Beteiligten verändert.</p> <p>Am Institut für Interaktive Systeme der Technischen Hochschule Lübeck wurden früh Strukturen geschaffen, die Mitarbeitenden Raum zur Erprobung und Selbstreflexion im Umgang mit KI-Werkzeugen bieten. Im Rahmen des Forschungsprojekts European-Digital-Innovation Hub (EDIH.SH) entstand eine Fallstudie, die untersucht, wie verschiedene KI-Werkzeuge in den unterschiedlichen Phasen des Instruktionsdesign-Prozesses eines mehrsprachigen Selbstlernangebots didaktisch reflektiert eingesetzt werden können. Dabei wird KI von den Instruktionsdesignenden zunehmend als Co-Designender wahrgenommen, was Auswirkungen auf Rollenverständnis, Verantwortung und die Zusammenarbeit zwischen Fachexpert*innen, Instruktionsdesignenden und Medienproduzierenden hat.</p> <p>Die qualitative Reflexion des strukturierten Einsatzes der KI-Werkzeuge ergab unter anderem:</p> <ul> <li>In der didaktischen Konzeptionsphase agieren Fachexpert*innen vermehrt als Qualitätsprüfende, während Instruktionsdesignende durch den Einsatz generativer KI als zusätzlicher „Autor“ mehr inhaltliche Verantwortung übernehmen.</li> <li>In der Medienproduktionsphase können KI-generierte Avatare in Lernvideos Inhalte präsentieren (etwa als Fallbeispiele). Dennoch ist aufgrund des technischen Entwicklungsstands und des Neuheitswertes ein didaktisches Framing durch eine „Real-Lehrperson“ aktuell sinnvoll.</li> <li>In der technischen Implementierungsphase beeinflusst die individuelle Expertise der Instruktionsdesignenden maßgeblich, ob und wie KI-Werkzeuge – beispielsweise als Coding-Partner – eingesetzt werden.</li> <li>Die Multilingualität des Selbstlernangebots spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie die eingesetzten KI-Werkzeuge während des Instruktionsdesign-Prozesses ineinandergreifen.</li> </ul> <p>Der Beitrag gibt einen anwendungsspraktischen Einblick in das Nebeneinander von Mensch und KI im Instruktionsdesign-Prozess und formuliert erste Thesen für einen lösungsorientierten und didaktisch reflektierten KI-Einsatz. Er versteht sich als Einladung zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit, hybride Mensch-KI-Kollaboration, transparente KI-Nutzung und reflektierten KI-Einsatz in digitalen Lernangeboten zusammenzudenken.</p> ID: 1144
/ DigIn - KI: 3
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Interaction Stichworte: Social Media, Sentiment Analysis, Negativity Detection, ChatGPT, Artificial Intelligence [Online] The Potential of ChatGPT for Sentiment Analysis of Social Media Conversations Universität Paderborn, Deutschland Social networks can significantly influence users' well-being, underscoring the need to identify and address the negative effects of social media use. In turn, recognizing and reducing harmful structures in digital communication is essential for fostering a healthier discourse and proposing potential interventions. Addressing this concern, this study investigates the potential of ChatGPT as a sentiment analysis tool for detecting negative patterns in social media conversations. Its effectiveness is assessed through quantitative and statistical analysis of specific datasets and compared against alternative sentiment analysis approaches. A growing body of research examines ChatGPT’s potential for artificial intelligence (AI)-supported text analysis, often showing promising results, but differing across domains, e.g., Amin et al. (2024); Wang et al. (2023); Bang et al. (2023); Mets et al. (2024); Rathje et al. (2024); Mousavi et al. (2024); Lossio-Ventura et al. (2024); Fatouros et al. (2023); Belal et al. (2023). Such previous evaluations of ChatGPT have primarily focused on a narrow range of tasks within the field of affective computing. Given the broad scope of this domain, this study aims to provide a more comprehensive assessment of ChatGPT’s capabilities across a diverse set of tasks. We specifically assess the use of ChatGPT for AI-based identification of several pre-identified negative structures in social media conversations. The findings show that ChatGPT is generally effective at identifying complex semantic and syntactic patterns. Thanks to its extensive training data, it can uncover implicit sentiments in both text and image input. Furthermore, its ability to explain these patterns in follow-up dialogues offers a distinct advantage over traditional sentiment analysis tools. However, the study also identifies clear limitations in ChatGPT’s application possibilities, as it does not perform reliably across all use cases. Our analysis reveals both the strengths and weaknesses of ChatGPT as a sentiment analysis system, highlighting scenarios where it is well suited to be used and where its use is not recommended. This study contributes to a deeper understanding of negative dynamics in social networks by demonstrating how conversational AI like ChatGPT can deliver rapid, insightful analyses of text-based communication. By identifying suitable and unsuitable contexts for its application, the research opens new avenues for integrating automated analysis into the broader field of computational social communication sciences. ChatGPT enables researchers and stakeholders to efficiently process and interpret large datasets from various sources, offering clear, data-driven insights, including the evaluation of patterns and correlations that may not be readily apparent through manual analysis. Its adaptability also allows for fine-tuning to meet specific research goals, making it possible to create more personalized and context-sensitive applications. | ||