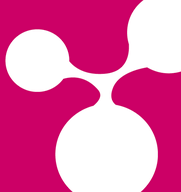GeNeMe 2025
Gemeinschaften in Neuen Medien
17. - 19. September 2025 in Dresden
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Sitzung | ||
Digitale Bildung: Kompetenzen
| ||
| Präsentationen | ||
ID: 1135
/ DigEd - Comp: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: KI-Kompetenzen, Lehrkräftebildung, Kompetenzentwicklung, Längsschnitt Längsschnittliche Untersuchung zum Einfluss des Besuchs von KI-Kursen auf die Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden 1Universität Leipzig, Deutschland; 2PH Schwäbisch Gmünd, Deutschland <p>Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) spielen nicht nur in der Arbeitswelt eine zunehmend bedeutsame Rolle, sondern verändern auch das Lernen und Unterrichten von Schüler:innen (Zawacki-Richter et al., 2019). Um Lernenden das Lernen mit und über KI pädagogisch-didaktisch sinnvoll nahezubringen, müssen Lehrpersonen selbst KI-Kompetenzen erwerben und befähigt werden, diese bei Schüler:innen zu fördern (Celik et al., 2022). Der Vortrag untersucht die Entwicklung KI-bezogener Kompetenzdispositionen bei angehenden Lehrkräften über ein Semester und bewertet, ob die Teilnahme an KI-bezogenen Kursen diese Dispositionen beeinflusst. Lehramtsstudierende spielen bei der Förderung von KI-Kompetenzen zukünftiger Schüler:innen eine zentrale Rolle (Miao & Cukurova, 2024), doch die Forschung zu KI-bezogenen Kompetenzdispositionen sowie deren Förderung bei Lehramtsstudierenden ist nach wie vor begrenzt (Schmidt, 2024). Aufgrund der Vielzahl an KI-bezogenen Kompetenzen, die angehende Lehrkräfte entwickeln müssen (vgl. AIPaCK-Modell, Lorenz & Romeike, 2023), besteht das Risiko, dass sie nicht ausreichend darauf vorbereitet sind, KI im schulischen Kontext zu unterrichten und einzusetzen.</p> <p>Auf Basis des Kompetenzkontinuum-Modells (Blömeke et al., 2015) und Einstellungsaspekten aus Technologieakzeptanzmodellen (Davis, 1989; Venkatesh & Davis, 2000) analysieren wir Veränderungen im KI bezogenen Wissen, in der intrinsischen Motivation, der Selbstwirksamkeit und in Einstellungen gegenüber KI und KI-Nutzung.</p> <p>Die Stichprobe umfasst <em>N</em> = 265 Lehramtsstudierende zweier deutscher Universitäten, von denen 72 sowohl die Eingangs- als auch die Folgebefragung ausgefüllt haben. Die Ergebnisse zeigen signifikante Zuwächse in der selbst eingeschätzten KI-Kompetenz, der KI-bezogenen Selbstwirksamkeit, positiven Einstellungen und der wahrgenommenen zukünftigen Berufsrelevanz. Teilnehmende, die KI-bezogene Kurse besucht haben, erzielen darüber hinaus zusätzliche Kompetenzgewinne. Die grundlegende KI-Kompetenz und das Interesse an KI bleiben stabil. Zudem zeigt sich, dass sowohl die allgemeine als auch die lehrerspezifische Selbsteinschätzung der KI-Kompetenz im Verlauf des Semesters zunimmt (Zeiteffekt). Die lehrerspezifische KI-Kompetenz hat dann besonders stark zugenommen, wenn die angehenden Lehrkräfte an einem KI-Kurs teilgenommen haben, was einen Interaktionseffekt zwischen Zeitverlauf und Kursbesuch verdeutlicht. Die Ergebnisse unterstreichen den Wert strukturierter Lerngelegenheiten im Bereich KI und sprechen dafür, dass Hochschulen gezielte KI-Kurse für Lehramtsstudierende anbieten sollten, um diese besser auf zukünftige Bildungsherausforderungen vorzubereiten.</p> ID: 1147
/ DigEd - Comp: 2
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education Stichworte: AI Literacy, Corpus Literacy, Critical Media Literacy, Data-driven Learning, secondary education (K-12) Statistisch lesen, kritisch schreiben: Corpus und AI Literacy im Dialog Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg, Deutschland Dieser Beitrag schlägt ein pädagogisches Rahmenkonzept vor, das AI Literacy und Corpus Literacy aus der Perspektive der Kritischen Medienkompetenz miteinander verbindet. Ziel ist es, Lernende mit den interpretativen, analytischen und ethischen Kompetenzen auszustatten, die erforderlich sind, um sich in einer zunehmend durch datengetriebene Technologien geprägten Welt zurechtzufinden. AI Literacy bezeichnet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, sprachbasierte KI-Systeme wie etwa große Sprachmodelle (LLMs) zu verstehen, zu bewerten und mit ihnen zu interagieren. Diese Kompetenz umfasst nicht nur funktionales Wissen – beispielsweise über die Funktionsweise und Potenziale dieser Modelle –, sondern auch eine kritische Bewusstheit über ihre sozio-technischen Grundlagen, einschließlich Fragen nach Verzerrungen (Bias), Intransparenz (Opazität), Autorenschaft und Automatisierung. Demgegenüber konzentriert sich Corpus Literacy auf die Fähigkeiten, Textdatensätze zu erkunden und analytisch zu bearbeiten. Dazu gehören Fertigkeiten wie die Identifikation sprachlicher Muster, das Formulieren empirischer Fragestellungen sowie die kontextbezogene Interpretation datenbasierter Ergebnisse. Obwohl diese beiden Kompetenzen voneinander getrennt erscheinen mögen, sind sie eng miteinander verknüpft: KI-Systeme werden auf Grundlage umfangreicher Textkorpora trainiert, und Korpusanalyse bietet Werkzeuge zur Untersuchung und Validierung KI-generierter Texte. Im Rahmen des Beitrags werden gemeinsame epistemologische Orientierungen beider Literacy-Konzepte hervorgehoben, darunter Mustererkennung, probabilistisches Denken sowie kritische Interpretationsfähigkeit, welche sich im Unterricht gegenseitig verstärken können. Praktische Anwendungen werden anhand konkreter Unterrichtsbeispiele und Lehrstrategien aufgezeigt, die Lernende gleichzeitig als Nutzer:innen und Forschende im Umgang mit KI positionieren. Beispielsweise können Lernende angeleitet werden, KI-generierte Texte als Hypothesen zu behandeln, die mittels korpusbasierter Vergleiche perspektiviert oder überprüft werden – eine Vorgehensweise, die einen rekursiven Dialog zwischen maschinengenerierten Inhalten und empirischer Textanalyse anregt. Durch die Integration dieser beiden Literacy-Bereiche innerhalb eines Rahmens werden Lernende nicht nur dazu befähigt, digitale Technologien kompetent zu nutzen, sondern auch kritische Fähigkeiten zu entwickeln, um algorithmisch generierte Texte interpretieren, hinterfragen und in ihren Kontext einordnen zu können. Solche Lernenden sind besser vorbereitet, die Zuverlässigkeit von Informationen einzuschätzen, die sozio-politischen Dimensionen von KI-Systemen zu verstehen und sich reflektiert an demokratischen sowie wissensgenerierenden Prozessen in einer zunehmend automatisierten Welt zu beteiligen. ID: 1117
/ DigEd - Comp: 3
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Education, Track - Digital Interaction Stichworte: Künstliche Intelligenz, Kompetenzentwicklung, AI Literacy, Stahlindustrie, Erwachsenenbildung [VIDEO] AI4SteelWorkers. Digitale Weiterbildung für KI-Kompetenzen in der Stahlindustrie thyssenkrupp Steel Europe AG, Deutschland Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Kompetenzentwicklung der Belegschaft traditioneller Industriezweige. Das betriebspraktische Projekt "AI4SteelWorkers" adressiert die Forschungsfrage, wie die Kompetenzentwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz in der Stahlindustrie durch zielgruppengerechtes elektronisches Lernen erfolgreich implementiert werden kann. Basierend auf einem sozialkonstruktivistischen Lernansatz wurde ein didaktisches Konzept entwickelt, das fünf Kernelemente umfasst: niedrigschwelliger Zugang, Praxisorientierung mit branchenspezifischen Anwendungsbeispielen, interaktive Lernelemente, multimediale Vermittlung und eine adaptive Lernerfahrung. Die Implementierung erfolgte nicht direktiv, sondern partizipativ. Zunächst wurde eine Informationskampagne durchgeführt, im Anschluss setzt das Projekt auf kollegiale Verbreitung, um die intrinsische Lernmotivation zu nutzen und zu fördern. Die einstündige E-Learning-Einheit vermittelt Grundlagen der KI, branchenspezifische Anwendungsszenarien, praktische Prompt-Engineering-Techniken und fördert die kritische Reflexion von KI-Outputs. Die Evaluation nach dem Kirkpatrick-Modell zeigt, dass innerhalb eines Zeitraums von elf Monaten 1479 Mitarbeitende das freiwillige Angebot in Anspruch nahmen, wobei 61% aus dem gewerblichen Produktionsbereich stammen – einer traditionell schwer erreichbaren Zielgruppe. Die durchschnittliche Zufriedenheitsbewertung liegt bei 4,44 von 5 Punkten (n=215). 64% der Teilnehmenden absolvierten die freiwillige Lernerfolgskontrolle erfolgreich. Es liegen qualitative Beobachtungen von zehn Teilnehmenden vor, die einen Transfererfolg durch konkrete KI-Anwendungen im Arbeitsalltag belegen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Implementierung von KI-Kompetenzen in traditionellen Industrieumgebungen durch die erfolgreiche Anwendung praxisnaher, niedrigschwelliger E-Learning-Angebote, die durch kollegiale Verbreitung unterstützt werden, einen signifikanten Erfolg verspricht. Die hohe Teilnahmequote aus der Produktionsebene veranschaulicht das Potenzial kontextspezifischer Lernangebote. Es bestehen methodische Limitationen in möglichen Selbstselektionseffekten und der begrenzten Repräsentativität der qualitativen Stichprobe. Der gewählte Ansatz bietet ein Transferpotenzial für andere Organisationen, insbesondere im produzierenden Gewerbe, wobei branchenspezifische, kulturelle und organisationale Faktoren zu berücksichtigen sind. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Demokratisierung von KI-Wissen und zum gesellschaftlichen Diskurs über künstliche Intelligenz in traditionellen Arbeitskontexten. ID: 1112
/ DigEd - Comp: 4
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Education Stichworte: KI-bezogene Lehr-Lern-Angebote, Lehrkräftebildung, Berufsbegleitende Qualifizierung [krank] Fachspezifischer Kompetenzaufbau zu Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lehrkräftebildung: Lehr-Lern-Angebote zu KI im Deutschunterricht ZLSB, TU Dresden, Deutschland <p>Künstliche Intelligenz ist bereits in unseren Alltag integriert. Zunehmend wird auch der Aufbau von KI-bezogenen Kompetenzen in Schule und Unterricht gefordert. Um das zu ermöglichen, muss das Thema in der Lehrkräftebildung aufgegriffen und Angebote geschaffen werden. Auf diese neuen Herausforderungen sind Lehrkräfte fachspezifisch vorzubereiten.</p> <p>Der Beitrag präsentiert an zwei Beispielen aus dem Fach Deutsch, wie die Funktionsweise von KI in der Lehrkräftebildung erfahrbar gemacht werden kann und wie diese Angebote fachspezifisch profiliert werden können. Ziel der Lehr-Lern-Angebote ist es, die Teilnehmenden im Seminar für die Potenziale und Herausforderungen im Umgang mit KI zu sensibilisieren und ihnen handlungsnahe Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen, die einen Transfer in Schule und Unterricht ermöglichen.</p> <p>Im ersten Lehr-Lern-Angebot wird mit den Teilnehmenden eine exemplarische Deutschstunde zur Interpretation eines kanonischen Gedichtes für die Sekundarstufe I erprobt. Die Teilnehmenden sind dabei in der Schüler:innenrolle und erleben, wie der auf KI-basierende Chatbot ChatGPT unterrichtlich in die Auseinandersetzung mit einem Gedicht eingebunden werden können. Dazu bearbeiten sie in Kleingruppen zunächst arbeitsteilig verschiedene Analyse- und Interpretationsaufträge und dokumentierten ihre Ergebnisse mithilfe einer digitalen Pinnwand. Anschließend wird ChatGPT mit unterschiedlichen Prompts nach einer Analyse und Interpretation des Gedichts gefragt, um zu eruieren, wie tragfähig die Deutungen des Chatbots sind. Die generierten Antworten werden unter Bezugnahme auf die Befunde der Teilnehmenden kritisch diskutiert, sodass Stärken und Schwächen der KI deutlich werden. Bestimmt wird die abschließende Diskussion von der Frage, wie der Umgang mit KI didaktisch zu rahmen ist.</p> <p>Das zweite Lehr-Lern-Angebot widmet sich dem unterstützenden Einsatz der KI bei der Unterrichtsplanung. Zur Ermittlung der diesbezüglichen Potenziale und Herausforderungen von KI werden KI-generierte Unterrichtsstunden zu zwei exemplarischen Texten des Deutschunterrichts kritisch reflektiert. Die Basis dafür bildet eine zuvor durch die Teilnehmenden vorgenommene didaktische Analyse der Lerngegenstände. Während die unterrichtliche Umsetzbarkeit grundsätzlich plausibel erscheint, zeigen sich Überarbeitungsbedarfe bei der Gegenstandsangemessenheit der Planungsvorschläge, die durch die Lehrkräfte geleistet werden müssen.</p> <p>Der Beitrag bietet Einblicke in zwei fachspezifisch profilierte Lehr-Lern-Angebote zum Aufbau KI-bezogener Kompetenzen in der Lehrkräftebildung. Beschrieben werden die Konzeption der Angebote im multiprofessionellen Team sowie zentrale Beobachtungen zu den Stärken und Schwächen von KI im Deutschunterricht und bei der Planung von Deutschunterricht. Daraus werden in einem Fazit Professionalisierungsbedarfe für eine digitalisierungsbezogene wie fachspezifische Lehrkräftebildung abgeleitet.</p> ID: 1130
/ DigEd - Comp: 5
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Life Stichworte: Digital Literacy, Informed Citizenship, AI, Parental Attitudes Digital Competence, Citizenship, and Parental Attitudes Towards Artificial Intelligence: German Insights Parents International, The Netherlands <p>This study presents findings from the qualitative component of the Erasmus+ Research Project DRONE, which aims to enhance digital literacy and combat disinformation among vulnerable adolescents through a holistic ecosystem approach. It explores the views of 25 parents on digital competence, informed citizenship, and AI in the context of their children’s digital upbringing.</p> <p>Digital Literacy was universally prioritized among all participants. All parents stressed the importance of digital devices, software, platforms, online safety, and critical thinking. Netiquette was frequently mentioned, and over half highlighted the importance of deciding when and how to engage digitally. Some referred to understanding AI as part of digital competence. All invested in their children’s digital literacy and considered their own skills adequate. All had seen fake content; 23 were confident in detecting it. Half noted that context often influences whether content is considered disinformation.</p> <p>On Informed Citizenship, all parents valued staying informed, yet none reported digital literacy education at school. Their main news sources included websites (16), social media (17), TV/radio (13), family (19), friends (14), and newspapers (7), underlying the importance of family as a source of information and its value on digital literacy.</p> <p>Regarding Training and Educational materials most parents reported its informal nature. 23 parents were self-taught in digital literacy and AI, 22 learned from family, and over half from friends. No one was aware of school-based training, underlying the lack of formal training channels for parents but at the same time underlying their importance as educators to their children when see these results in relation to the results regarding inform citizenship.</p> <p>AI Awareness and Knowledge was high. All 25 parents knew about AI, including chatbots (17), translators (19), surveillance tools (14), and social media algorithms (15). All could create strong passwords, 19 used editing tools confidently. Nineteen used AI services regularly. Awareness of data sharing and targeted ads was universal. When in doubt about digital content, 23 consulted friends/family, and 12 asked their children. Interest in new tech varied: 15 high, 5 moderate, 5 low.</p> <p>Perceptions of AI were mixed: 17 said its impact depends on context, 7 saw it as minor, and 3 as significant. Concerns included job loss (14), data misuse (9), and fear of the unknown (17). Benefits included task ease (24), learning support (11), content creation (10), and work use (12). Common uses were translation (18), homework (7), and content production (12).</p> | ||