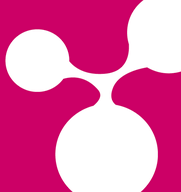GeNeMe 2025
Gemeinschaften in Neuen Medien
17. - 19. September 2025 in Dresden
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Sitzung | ||
Digitale Gesundheit & Inklusion
| ||
| Präsentationen | ||
ID: 1145
/ DigHI: 1
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Health & Inclusion Stichworte: Digitalisierung im Gesundheitswesen, Elektronische Patientenakte, ePA, Akzeptanz, Technologieakzeptanzmodell, Digitale Gesundheitskompetenzen, EHealth Akzeptanz der elektronischen Patientenakte (ePA) und Implikationen zur Erhöhung der Nutzungsbereitschaft – Ergebnisse einer quantitativen Studie in Aachen-Burtscheid University of Applied Science CBS mit EUIFH, Deutschland <p>Die pseudoanonymisierte Bereitstellung der Gesundheitsinformationen aus der elektronischen Patientenakte (ePA) steigert die Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland immens. Im Zuge einer flächendeckenden Nutzung der ePA lassen sich deutlich mehr medizinische Daten erheben, die Rückschlüsse für ganzheitliche Therapien, Pflegeansätze und für die Gesundheitsberichterstattung, aber auch die Forschung bieten (Haug et al. 2024). Allerdings ist die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems, insbesondere was die Einführung der ePA betrifft, im europäischen Vergleich marginal. Während andere europäische Länder langjährig und erfolgreich die Implementierung einer ePA abgeschlossen haben, kann in Deutschland - weder auf Seiten der Leistungserbringer noch auf Seiten der Nutzenden – eine Durchdringung festgestellt werden. Ursächlich für die Leistungserbringer sind fehlende Informationen bezüglich der Nutzungsmöglichkeiten und dem Mehrwert der ePA, was wiederum die Bereitschaft zur Einführung und Nutzung dieser, insbesondere im hausärztlichen Setting mindert (Konopik et al. 2024; Urbanek 2022). Umfängliche Prozesse, die für Datenschutz und -umgang erforderlich sind, verzögern den Einführungsprozess. Möglicherweise stellen fehlende digitale Gesundheitskompetenzen einen weiteren Erklärungsansatz dar (Schaeffer et al. 2021; Schaeffer & Gille 2022). Auf Seiten der anvisierten Nutzenden der ePA ist die Datenlage gegenwärtig zu gering, um Ursachen für die Zurückhaltung zu eruieren.</p> <p>Der Beitrag setzt an diesem Desiderat an und nähert sich auf Basis des Technologieakzeptanzmodells von Davis (1986) der Exploration von Faktoren, die auf die Verhaltensabsicht und Adaption der ePA einen Einfluss besitzen. Hierfür wurde eine quantitative Fragebogenerhebung (n = 102) im Stadtteil Aachen-Burtscheid aus dem Jahr 2024 realisiert, um den Einfluss der Faktoren Alter, Digitalkompetenz, digitale Gesundheitskompetenz, wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit, Bedenken, Outputqualität und Persönlichkeitsfaktoren herauszuarbeiten. Auf Basis von statistischen Analysen lässt sich im Ergebnis feststellen, dass die Nutzung der elektronischen Patientenakte im Stadtteil Aachen–Burtscheid zum aktuellen Zeitpunkt gering ausgeprägt ist. Demgegenüber ist ein positiver Trend bei der Nutzungsabsicht der ePA zu verzeichnen. Die Nutzungsabsicht wird primär durch die Bedenken bei der Nutzung und durch die erkannte Outputqualität beeinflusst. Ebenfalls konnte ein geringer Zusammenhang zu den Faktoren „Digitalkompetenz“, „Unterstützungsbedarf“, „Selbstwirksamkeit“ und „wahrgenommenen Nützlichkeit“ und „Benutzerfreundlichkeit“ festgestellt werden. An diesen Punkten anknüpfend, können Handlungsempfehlungen für Krankenkassen abgeleitet werden, um die Transformation der ePA zu beschleunigen.</p> ID: 1118
/ DigHI: 2
Forschungsbeitrag Themen: Track - Digital Education, Track - Digital Health & Inclusion, Track - Digital Interaction Stichworte: Inklusive Hochschulbildung, Assistenzsysteme, Barrierefreiheit, Augmented Reality, Implementierung Barrierearme Hochschullehre mit informationstechnischen Assistenzsystemen – Entwicklung des Implementierungsmodell INARE für Augmented Reality 1Hochschule Zittau/Görlitz, Deutschland; 2Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland Barrierearme Hochschullehre ist ein zentrales Ziel der digitalen Transformation. Trotz vielversprechender informationstechnischer Assistenzsysteme bleibt das Potenzial von Augmented Reality (AR) zur Kompensation von Behinderungen weitgehend ungenutzt. Unser Beitrag stellt das INARE-Modell (INclusive Augmented Reality for Education) vor. Dabei handelt es sich um einen systematischen, phasenorientierten Leitfaden zur barrierearmen Implementierung von AR über Head-Mounted Displays (HMD) in der Hochschullehre. Methodisch kombiniert INARE eine qualitative Expert*innenbefragung mit einer systematischen Literaturrecherche. Die Befragung fand in Form eines moderierten Workshops statt, in dem die Teilnehmenden AR-Anwendungen selbst ausprobierten und in Gruppen diskutierten. Die Literaturanalyse folgte den PRISMA-Richtlinien und identifizierte Kernstudien zur AR-Implementierung. Die Ergebnisse der Befragung und der Literaturrecherche zeigen, dass AR in der Hochschullehre bislang selten didaktisch fundiert oder inklusiv konzipiert wird. Es besteht Konsens darüber, dass eine multisensorische Unterstützung – beispielsweise visuelle AR-Inhalte, die um Audiosignale und haptisches Feedback ergänzt werden – unerlässlich ist, um Studierende mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen aktiv einzubinden. Zudem erfordert die Entwicklung solcher Anwendungen eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Softwareentwickler*innen. Auf Basis dieser Erkenntnisse definiert INARE sechs Phasen: Analyse, Design, Entwicklung, Implementierung, Evaluation und Skalierung sowie vier Handlungsbausteine: Organisation, Didaktik, Inklusion und Technologie. Die Limitationen betreffen die geringe Stichprobe der Expert*innenbefragung, die Beschränkung auf HMD-Systeme und die fehlende direkte Einbindung von Menschen mit Behinderungen. Die Literaturrecherche ist zudem auf den Zeitraum 2020–2025 und englischsprachige Quellen begrenzt. Als Ausblick empfehlen die Autor*innen, dass zukünftige Forschung das INARE-Modell partizipativ mit Betroffenen weiterentwickeln, in disziplinübergreifenden Studien validieren und um kostengünstige AR-Plattformen erweitern sollte. Sie laden die Hochschul-Community ein, das INARE-Modell kritisch zu prüfen, weiterzuentwickeln und damit AR als inklusives informationstechnisches Assistenzsystem allen Studierenden zugänglich zu machen. ID: 1159
/ DigHI: 3
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Life, Track - Digital Health & Inclusion, Track - Digital City Stichworte: Digitale Teilhabe Mittler*in Informelles Lernen Typenbildung Ältere Erwachsene [Online] Typisierung von Mittler*innen: Förderung digitaler Teilhabe in Kontexten informellen Lernens älterer Erwachsener 1Katholische Hochschule NRW (katho), Deutschland; 2Bildungszentrum Universitätsklinikum Düsseldorf <p>Digitalisierung und Digitalität (Hauck-Thum & Noller, 2021; Stalder, 2021) durchziehen und verändern alle Lebensbereiche. Es entstehen Netzwerke aus menschlichen und nicht-menschlichen Komponenten (Kerres, 2023) und multiple Möglichkeiten digitaler Teilhabe (Ehlers et al., 2020). Gleichzeitig können digitalisierungsbezogene Veränderungen Teilhabe beeinträchtigen. Beispiel hierfür sind die Digitalisierung analoger Verfahren (Ticketkauf) und die Verpflichtung zum Schutz eigener Daten durch User*innen. Aus den Möglichkeiten der Digitalisierung werden alternativlose Anforderungen (Barczik et al., 2021; Reissmann et al., 2022). Die digitale Transformation stellt besonders ältere Erwachsene vor Herausforderungen und kann sich durch unreflektierte Nutzung oder Ablehnung von Anwendungen auf die individuellen Teilhabechancen auswirken (Initiative D21 e. V., 2024).</p> <p>Im Zusammenhang mit der Förderung digitalisierungsbezogener Teilhabe Älterer nehmen freiwillige Mittler*innen, die Angebote zum Umgang mit digitalisierungsbezogenen Anforderungen bereitstellen, eine bedeutende Rolle ein (Barczik et al., 2021; Doh et al., 2021; Stiel et al., 2018). Neben diesen aufsuchenden Optionen erhalten ältere Erwachsene auch Unterstützung direkt in ihrer Lebenswelt durch Angehörige oder beruflich Pflegende (Hölterhof et al., 2025 (in Print); Thalhammer, 2018). Beide agieren als ‚warm experts‘ und unterstützen bei technischen Fragestellungen, leiten gezielt an oder übernehmen Handlungen (Bakardjieva, 2005; Geerts et al., 2023).</p> <p>Obgleich deutlich wird, dass unterschiedliche Arten von Mittler*innen für digitalisierungsbezogene Unterstützung existieren, fehlen differenzierte Betrachtungen dieser verschiedenen Typen, ihrer Vorstellungen vom Mittler*in-Sein und Handlungsmuster.</p> <p>Das BMBF-Projekt CrossComITS setzt hier an und untersucht die Befähigung zur digitalen Teilhabe von vulnerablen Gruppen in Bezug auf IT-Sicherheit. Auf Basis einer qualitativen Analyse (Kuckartz & Rädiker, 2024) von leitfadengestützten Interviews mit unterschiedlichen Mittler`*innen (freiwillig Engagierte, beruflich Pflegende) sowie der ergänzenden Perspektiven von Kursteilnehmenden aus Workshops zu Themen der IT-Sicherheit wird eine qualitative Typisierung (Kelle & Kluge, 2010) von Mittler*innen für das informelle digitalisierungsbezogene Lernen älterer Erwachsener durchgeführt. Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen.</p> <p>Eine Typisierung kann dabei unterstützen, die Bedeutung des Mittler*in-Seins zu reflektieren und Ansatzpunkte für die Gestaltung passgenauer Unterstützungsangebote für ältere Menschen sowohl im freiwilligen Engagement als auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung Pflegender bieten und einen wichtigen Beitrag zur Förderung der digitalen Teilhabe älterer Menschen leisten. In weiterer Forschung könnten die Wechselwirkungen zwischen Mittler*innen-Typen und Lernerfolgen älterer Erwachsener untersucht und Empfehlungen für Politik, Bildungsträger und Communities abgeleitet werden.</p> ID: 1126
/ DigHI: 4
Projektbeitrag (Work In Progress) Themen: Track - Digital Health & Inclusion Stichworte: organisationale Resilienz, digitale Risiken, Digitalisierung, Gesundheitsorganisationen, digitale Resilienz Digitale Resilienz: Herausforderung und Notwendigkeit in Gesundheitsorganisationen 1Evangelische Hochschule Dresden [EHS], Deutschland; 2Technische Universität Chemnitz, Deutschland <p>Jüngste Krisen im Gesundheitswesen wie die COVID-19-Pandemie haben die Schwächen der Gesundheitsversorgungssysteme deutlich gemacht (Hack-Poley et al. 2023; Cobianchi et al. 2020). Technologische Innovationen können dabei eine zentrale Bedeutung für die Weiterentwicklung von Gesundheitsorganisationen darstellen (Hack-Poley et al. 2023). So kann z.B. der Einsatz digitaler Technologien – etwa die elektronische Patientenakte – nachweislich Effizienz und Versorgungsqualität verbessern (Pool et al. 2024; Chandwani et al. 2018; Kohli & Tan 2016; Stephanie & Sharma 2020).</p> <p>Gleichzeitig bringt die Digitalisierung erhebliche Risiken mit sich. Gesundheitsorganisationen sind besonders anfällig für Datenschutzverletzungen und Cyberangriffe wie Phishing, Malware oder Ransomware (Pool et al. 2024; Gordon et al. 2017; Tab. 1). Solche Angriffe gefährden nicht nur die Daten- und Versorgungssicherheit, sondern können auch direkte gesundheitliche Schäden bei Patient:innen verursachen, etwa durch Angriffe auf medizinische Geräte (Halperin et al. 2008; Li et al. 2011). Damit wird die Cybersicherheit im Gesundheitswesen zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema (Liu et al. 2022; Tab. 2).</p> <p>In Anbetracht divers auftretenden digitalen Risiken, ist <strong>Resilienz</strong> als die Fähigkeit von Organisationen, Krisen und Veränderungen vorherzusehen, zu bewältigen und daraus zu lernen, von enormer Bedeutung (Duchek 2020; Hepfer & Lawrence 2022). Organisationale Resilienz umfasst 3 Phasen:</p> <ol start="1" type="1"> <li><strong>Antizipation</strong> (vor dem Ereignis),</li> <li><strong>Bewältigung</strong> (während des Ereignisses) und</li> <li><strong>Anpassung</strong> (nach dem Ereignis).</li> </ol> <p>Im Zeitalter der Digitalisierung, in der der Einsatz von Daten und algorithmischen Systemen für neue Prozesse und Geschäftsmodelle eine Konstante ist (BMWK (2024), ist für die Resilienz von Organisationen insgesamt insbesondere ihre digitale von zentraler Bedeutung. <strong>Digitale Resilienz </strong>beschreibt im Gesundheitswesen die Fähigkeit, digitale Risiken (z. B. durch Stromausfälle, KI-Einsatz) frühzeitig zu erkennen, im Ernstfall wirksam zu reagieren und aus Vorfällen zu lernen (Abb. 1).</p> <p>Da in Deutschland bislang unklar ist, wie (1) eine langfristig stabile Nutzung digitaler Technologien –im komplexen System Krankenhaus sichergestellt werden kann, und (2) wie technologische Risiken wie Datenmissbrauch oder der Ausfall medizinischer Infrastruktur die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von Krankenhäusern und ihren Akteur:innen beeinflussen, untersucht das Forschungsprojekt „Digitale Resilienz von Krankenhäusern in Sachsen“ (DiReK), das im September 2023 startete und gemeinsam von der TU Chemnitz und der ehs Dresden durchgeführt wird, wie sächsische Gesundheitsdienstleister mit digitalen Risiken umgehen, und wie sich dies auf ihre organisationale Resilienz auswirkt. Grundlage bildet eine quantitative Befragung der Krankenhäuser in Sachsen, und darauf aufbauend Fallstudien.</p> | ||