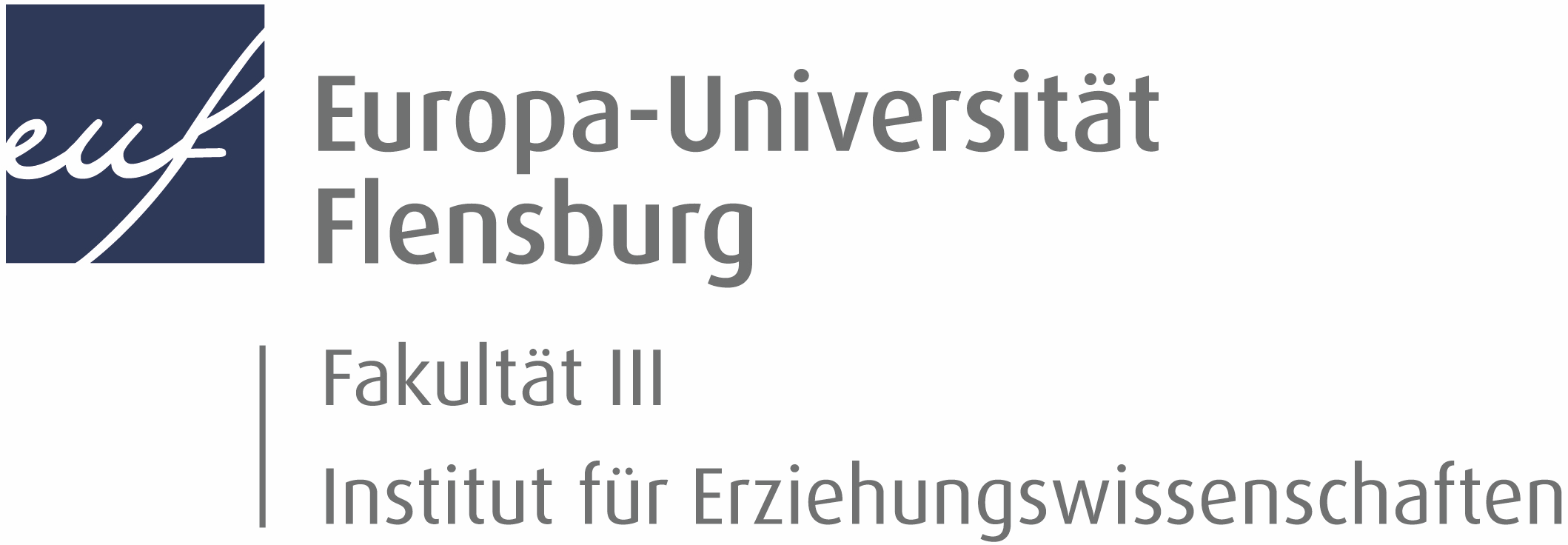Jahrestagung der DGfE-Kommission
Schulforschung und Didaktik
10. bis 12. September 2025, Flensburg
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Mittwoch, 10.09.2025 | |
| 14:30 - 15:00 | Begrüßung Ort: HEL 160 |
| 15:00 - 16:00 | Erziehung unmöglich!? Diskursanalytische Einblicke und Blindflecke in Erzählungen von ausgestiegenen Lehrkräften (Anne Kirschner - Heidelberg) Ort: HEL 160 Chair der Sitzung: Marion Pollmanns |
| 16:00 - 16:30 | Kaffeepause |
| 16:30 - 18:30 | Arbeitsgruppe I Ort: HEL 161 |
|
|
Auf dem Weg zum Schulkind: Praktiken der schulischen Erziehung am Anfang der Schulzeit Der Beginn von Schule und der Anfangsunterricht werden vor allem kompetenztheoretisch hinsichtlich des Gelingens des Übergangs in die Schule erforscht (Deckert-Peaceman/Scholz 2016). Neben fachlichen Kompetenzen wird auch ,gelehrt‘ und ‚gelernt‘, wie Schule und Unterricht funktionieren und wie sich Kinder als Schüler:innen verhalten sollen. Aktuelle Studien zeigen, dass die Transition vom Kind zur Schüler:in durch Praktiken erfolgt, die Disziplin(ierung), Regeln, Rollen und Normen umfassen, in denen ,Schule‘ und ,Schüler:in-Sein‘ hervorgebracht werden (Deckert-Peaceman/Scholz 2016; Hess 2020; Jäger 2019; Kelle 2023; Kellermann 2008; Wenzl 2010; Wolter 2016). Das Symposium untersucht die Frage, wie hierbei Praktiken der Erziehung hervorgebracht werden und wie sie zu anderen schulischen Praktiken zu relationieren sind. Dazu ist auch eine theoretische wie empirische Verhältnisbestimmung zwischen Disziplinierung und Erziehung vorzunehmen. Auf theoretischer Ebene können beide Konzepte dadurch abgegrenzt werden, dass Erziehung auf Mündigkeit und Autonomie abzielt, Disziplinierung hingegen zur Herstellung schulischer Ordnung dient (Breidenstein 2025). Empirisch ist zu fragen, inwiefern Erziehungs- und Disziplinierungspraktiken sich unterscheiden oder überlagern. Im Symposium soll ein empirisch zu konkretisierendes Verständnis von Erziehung zugrunde gelegt werden, das sich auf Einwirkungsversuche auf Schüler:innen bezieht, um eine pädagogische Ordnung herzustellen (Budde 2020). In drei Beiträgen aus laufenden ethnografischen Forschungsprojekten zum ‚Beginn von Schule und Unterricht‘ wird erkundet, wie Erziehung am Anfang der Schulzeit praktisch hervorgebracht wird. Damit bearbeitet das Symposium das Desiderat einer empirischen Erforschung von Erziehung in Schule (Breidenstein 2025). Die Beiträge untersuchen erstens Modi des Erziehens, zweitens den Zusammenhang von Erziehung und Leistung und drittens die erzieherische Dimension in der Herstellung von Differenz. 1. Beitrag: Bisher wird sich kaum mit der Frage beschäftigt, auf welchen Weisen in der alltäglichen Unterrichtspraxis erzogen wird. Im Fokus stehen herausgehobene Arten des Erziehens, wie Trainingsräume (z.B. Hertel 2015), und einzelne ,Zieldimensionen‘ des Erziehens, v.a. der Körper (z.B. Jäger 2019). Demgegenüber entfaltet der Beitrag eine Systematisierung zu alltäglichen Modi des Erziehens. Grundlage dafür ist ein ethnografisches Forschungsprojekt zur Sozialisation am Schulanfang in den USA, das im Sommer 2024 an sechs Grundschulen durchgeführt wurde. Die Daten zeigen, dass sich Erziehen ganz unterschiedlich vollzieht: auf Individuen oder auf (anonyme) Kollektive bezogen; öffentlich, halb-öffentlich oder privat; lobend, tadelnd, moralisierend, auf Selbsteinsicht zielend oder prospektiv-motivierend; im Zusammenspiel von Lehrperson, Materialitäten, Regel- oder Belohnungssystemen. Abschließend geht der Beitrag auf die Frage nach der Spezifik von Erziehung in der US-amerikanischen Grundschule ein. 2. Beitrag: Im Anfangsunterricht werden nicht nur die wichtigsten Kulturtechniken vermittelt, sondern auch, wie Schule und Unterricht funktionieren (Hanke 2019) und wie schulische Leistung als Kernelement der schulischen Ordnung (Rabenstein et al. 2015) zu erbringen ist. Ein sozialkonstruktivistischer Zugriff auf Leistung unterstreicht, dass Leistungspraktiken als Zusammenhang aus fachlichen und erzieherischen Praktiken bzw. aus Wissen und Verhalten besteht (Budde et al. 2022; Blasse/Budde 2024). Im Beitrag werden ethnografische Beobachtungen in einer ersten Klasse dahingehend analysiert, inwiefern und wie Erziehungspraktiken im Anfangsunterricht auf die Hervorbringung schulischer Leistung gerichtet sind. Welche Rolle spielen erzieherische Praktiken im Anfangsunterricht in Bezug auf das Anliegen der Leistungserbringung? Somit soll ein empirische Beschreibung von Erziehung in ihrer Relevanz für die Aneignung eines leistungsbezogenen Schüler:innen-Verhaltens erbracht werden. 3. Beitrag: Der Beitrag untersucht die Genese schulischer Differenzordnungen am Beginn der Grundschule entlang von Vorstellungen ‚guter Kindheit‘ sowie Leistungs- und Verhaltenserwartungen. Diese werden u.a. durch Praktiken des ‚doing background‘, also durch die performative Herstellung von Herkunftsbezügen, hervorgebracht (Machold/Wienand 2021). Schulische Erziehungspraktiken zielen auf die Herstellung und Aufrechterhaltung schulischer Ordnung, in denen Schüler:innen als in spezifischer Weise ‚erziehungsbedürftig‘ adressiert werden (Breidenstein 2025). Im Fokus steht die Frage, in welchem Verhältnis Praktiken des ‚doing background‘ mit Erziehungspraktiken am Beginn der Grundschule stehen. Grundlage der Analyse ist ein ethnografisches Dissertationsprojekt. Durch die teilnehmende Beobachtung an Anfangsunterricht sowie Team- und Elterngesprächen werden soziale Praktiken untersucht, mit denen (Hintergrund-)Wissen über Schüler*innen sowie backgroundbezogene Differenzordnungen hervorgebracht werden. Beiträge des Symposiums Modi des Erziehens am Schulanfang. Ethnografische Befunde aus dem US-amerikanischen Grundschulunterricht Erziehung zur schulischen Leistung im ersten Schuljahr? Backgroundbezogene Differenz und Erziehung am Beginn der Grundschule |
| 16:30 - 18:30 | Arbeitsgruppe II Ort: HEL 166 |
|
|
Erziehung im Vollzug - Empirische Analyse in Kindertagesstätte, Grundschule und Gymnasium Das Symposium stellt drei aktuelle Projekte zur Diskussion, die sich der empirischen Analyse von Erziehungspraktiken widmen, und möchte damit eine vergleichende Betrachtung der Praxis der Erziehung über die verschiedenen Stufen des deutschen Bildungssystems anregen. Die Projekte treffen sich trotz unterschiedlicher methodischer Herangehensweisen in ihrem grundlegenden Interesse an der konkreten interaktiven und situativen Prozessierung von „Erziehung“ im jeweiligen Feld. Dabei interessieren insbesondere die den Unterricht bzw. Kita-Alltag begleitenden, kleinen, eher beiläufigen Praktiken der Verhaltenssteuerung. Durch die vergleichende Diskussion der drei Projekte kommt die Spezifik der Erziehungspraxis auf der jeweiligen Stufe des Bildungssystems in den Blick: Im Elementarbereich erweist sich „Erziehung“ als das Kerngeschäft der Professionellen; im Primarbereich wird die Praxis der Erziehung von den Erfordernissen der Unterrichtsordnung aus entwickelt; im Sekundarbereich finden sich das Fachlehrer:innen-Prinzip und adoleszente Jugendliche – was bedeutet das jeweils für die Bedingungen und Grenzen institutioneller Erziehung? In der übergreifenden Diskussion soll es darüber hinaus um grundlagentheoretische Fragen und begriffliche Klärungen gehen: Wie lässt sich „Erziehung“ als sensibilisierendes Konzept für empirische Forschung bestimmen und etwa von Disziplinierung oder Vermittlung unterscheiden? Wie lässt sich das Phänomen der Erziehung, das in der Regel anlassbezogen auftritt und zugleich über die Situation hinausweist, indem Haltungen und Orientierungen aufgebaut oder korrigiert werden, praxistheoretisch einholen? Welche Formen der Instrumentierung von Erziehung lassen sich beobachten? Welche Einsichten werden für eine Weiterentwicklung von Erziehungstheorien eröffnen die empirischen Studien? 1. Arnd Michael Nohl: Erziehung in Kindertagesstätten und ihre interaktive Einbettung Obwohl seit dem PISA-Schock auch Kindertagesstätten vornehmlich als Orte der Bildung angesehen werden, finden sich in ihnen vielfältige Erziehungspraktiken – verstanden als nachhaltige und sanktionsbewehrte Zumutung von Orientierungen. Anhand von 63 Stunden videographierten Alltags in drei Kindertagesstätten ließ sich in einem DFG-Projekt mittels der Dokumentarischen Methode rekonstruieren, wie pädagogische Fachkräfte dann, wenn sich situativ Gelegenheiten bieten, Kinder proaktiv oder reaktiv erziehen (Nohl & Dehnavi 2023). Der Beitrag wird vor allem der Frage nachgehen, wie die Gruppenöffentlichkeit solcher erzieherischer Interaktionen mit deren Nachhaltigkeit verknüpft ist. 2. Georg Breidenstein: Erziehungspraktiken und Unterrichtsorganisation in der Grundschule Ob es einen eigenständigen schulischen „Erziehungsauftrag“ geben kann und soll ist umstritten (Idel 2018). Zumindest so viel Erziehung aber scheint notwendig, dass die Voraussetzungen für Unterricht hergestellt und aufrecht erhalten werden können. Der Beitrag geht auf Feldforschungen zurück, die an vier kontrastierenden Grundschulen die jeweilige Erziehungspraxis in den Blick nehmen (Breidenstein 2025). Diese Schulen unterscheiden sich sehr deutlich hinsichtlich ihrer unterrichtsorganisatorischen Grundlagen sowie in dem Stellenwert, den sie dem erzieherischen Handeln zusprechen und wie sie die erzieherische Praxis instrumentieren. Die Kontraste der Schulen übergreifend soll systematisierend gefragt werden, wie sich die erzieherische Praxis der Grundschule zur Vermittlungsaufgabe des Unterrichts relationiert, wie sie mit der situativen Kontingenz der Anlässe für Erziehung umgeht und wie sie „Personen“ als Adressat:innen von Erziehung konstituiert. 3. Nele Kuhlmann & Anne Sophie Otzen: Erziehungspraktiken am Gymnasium – Anerkennungstheoretische Perspektiven Ausgehend von einem Erziehungsverständnis, das zum einen die Operation des Zeigens (Prange 2005) und zum anderen die Moralität der Kommunikation betont (Oelkers 1992), untersucht der Beitrag unterrichtliche Erziehungspraktiken an einem Gymnasium. Die im Kontext eines DFG-Projekts videographierten Unterrichtsstunden werden daraufhin befragt, wie sich Erziehung als spezifisches Geschehen der Adressierung und Re-Adressierung situativ vollzieht, welche Normen der Anerkennbarkeit dabei relevant gemacht und welche Spannungen in der klassenöffentlichen Performanz greifbar werden (Kuhlmann & Otzen 2023). Dabei scheint insbesondere das für die Sekundarstufe relevante und erziehungstheoretisch kaum berücksichtigte Phänomen des ‚Gegenzeigens‘ von Schüler*innen interessant, das darin besteht, dass Schüler*innen auf die Legitimität der lehrpersonenseitigen Erziehung zeigen. Der Beitrag möchte diesen Aspekt pädagogischen Handelns erziehungstheoretisch diskutieren. Beiträge des Symposiums Erziehung in Kindertagesstätten und ihre interaktive Einbettung Erziehungspraktiken und Unterrichtsorganisation in der Grundschule Erziehungspraktiken am Gymnasium – Anerkennungstheoretische Perspektiven |
| 16:30 - 18:30 | Session Einzelbeiträge I Ort: HEL 167 Chair der Sitzung: Kerstin Rabenstein |
|
|
Erziehungshandeln von Lehrpersonen im Kontext von berufsorientierenden Kompetenzanalysen an Sekundarschulen Leibniz Universität Hannover, Deutschland Zum Start der Beruflichen Orientierung werden im 7. bzw. 8. Jahrgang stärkenorientierte Kompetenzanalysen durchgeführt (Driesel-Lange 2020), durch die Potenziale jenseits schulischer Leistungen sichtbar und für die individuelle Förderung nutzbar gemacht werden sollen (BMBF 2017, KMK 2017). Basierend auf einer laufenden ethnografischen Studie (Dahmen & Thielen 2024) beleuchtet der Beitrag die einzelschulische Prozessierung des an Assessmentcenter der Personalauswahl angelehnten Verfahrens am Beispiel der schulintern von Lehrkräften durchzuführenden Variante Profil AC Niedersachsen (Nds. Kultusministerium 2023) und knüpft an Ethnografien zur Beruflichen Orientierung an Schulen an (Budde & Weuster 2018; Dittrich & Walther 2020). An der Analyse von Beobachtungen zu informellen Feedbacksituationen im Zuge von handlungsorientierten Einzel- und Gruppenaufgaben sowie zu formalisierten Rückmelde- und Fördergesprächen zum Abschluss der Kompetenzanalyse werden Praktiken schulischer Ordnung rekonstruiert, im Zuge derer die durchführenden Lehrkräfte die Reflexionen mit erzieherischen Praktiken verknüpfen und dabei bisweilen auch die ressourcenorientierte Programmatik des Verfahrens unterlaufen. Ähnlich wie in Reflexionsformaten zu individualisiertem Lernen (Rabenstein et al. 2018) werden die Jugendlichen zur Anpassung an schulische Normen und zur Optimierung des Lern- und Arbeitsverhaltens aufgerufen (Bräu 2015; Bonanati 2018), wobei die Berufliche Orientierung in den Hintergrund gerät. Das Schulfach Pädagogik als erziehendes Fach? Zur Relation der Hervorbringung von Erziehungswissen und Erziehung im Pädagogikunterricht. 1Universität zu Köln, Deutschland; 2Universität Münster, Deutschland „Erziehung“ ist eine zentrale Dimension des gymnasialen Schulfaches Pädagogik. Sie ist curricular als Inhaltsfeld vorgegeben und wird im Unterricht, in Schulbüchern und in fachdidaktischen Konzeptionen als zu lernende Sache konstruiert. Zudem kann der Pädagogikunterricht selbst als Erziehungssituation betrachtet werden. In der Fachdidaktik wird das Fach mit dem erziehenden Anspruch verbunden, Schüler*innen für ihre eigene antizipierte erzieherische Praxis zu qualifizieren (Beyer 2012). Diese Doppelebene greift der geplante Einzelvortrag auf, indem Pädagogikunterricht aus einer praxeologischen (Roose 2003) und adressierungsanalytischen Perspektive (Kuhlmann 2023) betrachtet wird. Auf Basis dieser methodologischen Orientierung untersuchen wir die Relation von Erziehung als unterrichtete Sache und Erziehung als unterrichtlicher Prozess, die über die Rekonstruktion von sachbezogenen (Re-)adressierungen empirisch beschreibbar gemacht werden soll. Dabei steht zur Frage, wie und als was Erziehung als Sache des Unterrichts im Interaktionsgeschehen emergiert und darin mit Subjektivierungen (Ricken & Rose 2023) verflochten wird. Dazu werden videographierte Szenen aus dem Pädagogikunterricht sequenzanalytisch in den Blick genommen, in denen Erziehung in Familienkonstellationen thematisiert wird. Wer auf welche Weise in einer unterrichtlichen Erziehungssituation über Erziehung sprechen kann, ist aufschlussreich dafür, wie Erziehung als Sache inszeniert und als Prozess erkennbar wird. Kinderrechtsbezogenes Handlungswissen von Lehramtsstudierenden Uni Münster, Deutschland Die Kinderrechtskonvention bietet über die Differenzierung nach Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten sowie dem Kindeswohl einen normativen Rahmen für die Ausgestaltung von Schule und Unterricht (Rott et al. 2021). Dabei sind Erziehungsfragen in und durch die Institution Schule eng mit diesen Setzungen verbunden (Prengel et al. 2016). Das Verhältnis zwischen Erziehenden (Lehrpersonen) und den zu Erziehenden (Schüler*innen) ist geprägt durch diverse pädagogische Anforderungen (Keller-Schneider 2018), wie sie sich etwa im Phänomen Unterrichtsstörungen (Scherzinger et al. 2018) nachzeichnen lassen. Vorgestellt wird eine explorative Studie zu Handlungswissen von Lehramtsstudierenden (N=35) zur Umsetzung der Kinderrechte in Schule und Unterricht. Für die Studie wurden Fallvignetten (Barter & Renold 1999) entwickelt, zu denen Lehramtsstudierende Lösungsvorschläge formulieren sollten. Diskutiert wird eine Vignette zu Schutzrechten. Die nicht auflösbaren Verschränkungen zwischen Schutz vor Gewalt, Erziehungsrecht und Schutz der Privatsphäre wird über eine rekonstruktive Analyse von Bearbeitungen (N=3) herausgestellt. Rekonstruiert werden Argumentationsmuster (Kruse 2014), durch die deutlich wird, wie Lehramtsstudierende den schulischen Erziehungsauftrag wahrnehmen und über welches Handlungswissen (Mägdefrau & Schumacher 2001) sie verfügen. Abgeleitet werden Anknüpfungspunkte für weitergehende Studien zu kinderrechtsbezogenen Handlungswissen von (angehenden) Lehrpersonen. |
| Datum: Donnerstag, 11.09.2025 | |
| 9:00 - 9:30 | Ankommen |
| 9:30 - 10:30 | Die Institution erzieht nicht (Andreas Wernet - Hannover) Ort: HEL 160 Chair der Sitzung: Sandra Rademacher |
| 10:30 - 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 - 13:00 | Session Einzelbeiträge II Ort: HEL 161 Chair der Sitzung: Marion Pollmanns |
|
|
Bitte nicht so genau nehmen. Über das Phänomen, Aufgaben im Literaturunterricht ‚nicht wirklich‘ ernsthaft verfolgen zu sollen. Universität Göttingen, Deutschland Mit einem kritischen Gebrauch des Kulturbegriffs kann man der inflationären Rede von ‚Aufgabenkultur‘ die Frage nach Strukturen und Kontexten von ‚Aufgabenunkulturen‘ entgegenstellen. Kognitionspsychologische Ansätze in der Aufgabenkonstruktion kritisieren die Unschärfen von produktionsorientierten oder subjektorientierten Verfahren, umgekehrt werden die Aufgabenstellungen der psychologisch geschulten AufgabenkonstrukteurInnen von VertreterInnen der vermeintlich ganzheitlichen Aufgabenentwicklung als kleinschrittig kritisiert. Auf der einen Seite wird blind ‚gelernt‘, auf der anderen bereitwillig gemacht und oft eher ‚gekonnt‘, anstelle den Erwerb neuer Fähigkeiten anzubahnen. Beide Konzepte haben eine erzieherische Wirkung auf die Lernenden hinsichtlich des zum Schulgegenstand gewordenen literarischen Gegenstands. Im Vortrag sollen die erzieherischen Nebenwirkungen der vermeintlich lebensweltlichen/subjektorientierten Aufgaben anhand von Lehrmaterial und Unterrichtstranskripten vorgestellt und diskutiert werden. Was hält die SchülerInnen davon ab, diese Aufgaben als nicht ernsthaft bewältigbar abzulehnen? Könnten die Ergebnisse anders als beliebig sein? Wie wird damit im Unterricht sachbezogen umgegangen? Die Analyse erfolgt objektiv-hermeneutisch und soll insbesondere das Problem der Erziehung zur Unernsthaftigkeit im Modus von Didaktik fokussieren. "Und nur einer hat protestiert" - Zumutungen in der Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern im Unterricht Technische Universität Dortmund, Deutschland Erziehung im Unterricht kann als etwas angesehen werden, das in Praktiken (re-)produziert und sozial hergestellt wird. Ziel des Vortrages ist es, anhand einer praxeologisch fundierten Rekonstruktion von Interaktionen zwischen Lehrkräften und Schüler*innen einen Beitrag zur Logik und (Eigen-)Struktur von Erziehung zu leisten. Begriffstheoretisch wird Erziehung als Zumutung von Handlungsorientierungen verstanden (Nohl, 2018). Unterrichtstheoretisch geht es in Dimensionen der Interaktionsordnung um Momente des Mut-Machens und Zutrauens sowie des Verlangens von Handlungsweisen und wie diese inszeniert werden (Breidenstein, 2010). Datengrundlage bildet videographierter Unterricht in der Primar- und Sekundarstufe. Im Fokus stehen die Interaktionen zwischen den Lehrkräften unterschiedlicher Professionen und den Schüler*innen. Das Material wird anhand der dokumentarischen Videointerpretation (Bohnsack, 2011) sowie der dokumentarischen Unterrichtsforschung (Asbrand & Martens, 2018) rekonstruiert. Es wird eine sinngenetische Typenbildung vorgestellt, die u.a. anschlussfähig an Diskurse und Praktiken über Sorge, Delegierung, Disziplinierung und Ambivalenz ist. Ein Diskussionspunkt sind die Passungsverhältnisse zwischen Lehrkräften und Schüler*innen (Asbrand & Martens, 2020), die sich im Kontext der Unterrichtsdurchführung und dem Verhältnis von Erziehung im doppelten Sinne ausdrücken. Zudem wird die normative Struktur von Erziehung als Untersuchungsgegenstand diskutiert (Meseth, 2011). Die erzieherischen Dimensionen des Unterrichts Georg-August Universität Göttingen, Deutschland Mit dem Begriff der Erziehung ist im Kontext Schule oftmals eine normative Aufladung verbunden. Erziehung scheint so mit den Voraussetzungen des schulischen Lernens im Sinne einer Disziplin, sowie mit dessen Zielperspektive, nämlich Bildung, verbunden zu sein. In unserem Vortrag wollen wir die Frage nach der erzieherischen Dimension des Unterrichts aus einer praxistheoretischen Perspektive stellen. Wir folgen der These, dass Unterricht als eine soziale Ordnung immer wieder neu in Praktiken hergestellt wird (Schatzki 2002; Reh, Rabenstein, Idel 2011, S. 214), dass dem Vollzug von Unterricht insofern eine bestimmte Normativität inhärent ist (Wagenknecht 2020) und dass vor diesem Hintergrund unterschiedliche Erziehungspraktiken beobachtbar werden (Wicke, Rabenstein i.E.). In unserem Vortrag wir erstens unser praxistheoretisches Verständnis der erzieherischen Dimensionen von Unterricht. Zweitens gehen wir beispielhaft anhand eines Auszugs aus einem Protokoll teilnehmender Beobachtung aus einer ethnographischen Studie zur Konstitution der Schulklasse auf unterschiedliche Praktiken des Erziehens ein. Drittens differenzieren wir Praktiken des Erziehens, die wir auf Kontinuum zwischen impliziten und expliziten Varianten verorten. Wir schließen mit einem Resümee zur Frage, welchen Beitrag eine praxistheoretische Öffnung des Erziehungsdenkens für die schulpädagogische Forschung leisten könnte. |
| 11:00 - 13:00 | Session Einzelbeiträge III Ort: HEL 166 Chair der Sitzung: Karin Bräu |
|
|
Doing racial school?! Schulische Erziehungspraktiken im Kontext neoliberalisierter Rassismen Europa-Universität Flensburg, Deutschland Versteht man das ,Comeback der Erziehung‘ als ein mehr oder minder einschneidendes diskursives Ereignis erziehungswissenschaftlicher Theorie- und Begriffsbildung, dann ergeben sich für rassismuskritisch orientierte Schulforschungen (Melter & Mecheril 2009) mindestens zwei Möglichkeiten, an hegemoniale erziehungswissenschaftliche Diskurse anzuschließen und Anfragen an diese zu formulieren. Erstens rückt das Interesse an Erziehung in und durch Schule die normative Dimension schulischer Räume und Erfahrungen in den Fokus. Aus rassismuskritischer Perspektive werden damit etwa Analysen all jener Prozesse, Routinen und Praktiken bedeutsam, die Schule in nationalstaatlich codierten migrationsgesellschaftlichen Ordnungen institutionalisieren. Zweitens werden mit Erziehung in und durch Schule auf Seiten der Subjekte auch deren widerständige Werdungsprozesse thematisch. Rassismuskritische Theoriebildung liefert hier Einsichten in die Persistenz von Subjektivationsprozessen im Kontext differenzbezogener Zugehörigkeitsordnungen. In dieser Perspektivierung diskutiert der Beitrag ethnographische Einblicke der BMBF-Nachwuchsgruppe „Kontinuitäten und Neuformierungen von Institutionellem Rassismus in der Schule“ (Frank et al. 2025). Anhand unterschiedlicher Schulen und Schulformen wird die Vielgestaltigkeit und Etabliertheit von Erziehungspraktiken aufgezeigt, die als schweigsame und laute Rassialisierungen schulischer Normalität hervortreten und mit neoliberalen Orientierungen verwoben sind. Disziplinierung durch Schule? Allgemeine und spezifische Disziplinierung in schulischer Praxis der Grundschule Europa-Universität Flensburg, Deutschland Ausgehend von meinem Promotionsprojekt, in dem ich aus einer migrationspädagogischen Perspektive Disziplinierungspraktiken in der Grundschule ethnografisch und theoretisch-empirisch (Kalthoff u.a.; Kelle 2013; Mecheril 2025 i.E.) untersucht habe, frage ich danach, wie Erziehung durch Schule in einer differenz- und artikulationstheoretisch (Gottuck/Hoffarth 2022; Rangger 2024) sowie praxistheoretisch (Alkemeyer/Buschmann 2019) informierten Perspektive analysiert werden kann. Mit Disziplinierung (Foucault 1994; Sobiech 2022) untersuche ich Phänomene schulischer Praxis, die materiell-physisch am Körper ansetzen und durch Kontrolle und Eingewöhnung in eine Ordnung bringen. Ich setze voraus, dass schulische Praxis durch Differenzordnungen (Dirim/Mecheril 2018) wie Rassismus oder Sexismus vermittelt ist und vermittelt. Ich fokussiere mit Disziplinierung auf die Materialität schulischer Praxis, die macht- und zuweilen gewaltvoll auf Subjekte einwirkt, um eine Selbstführung durch Fremdführung herauszubilden (Benner 2015; Brumlik 2017). Ausgehend von Protokollausschnitten unterscheide ich zwischen einer allgemeinen Disziplinierung, die Kinder zu Schüler*innen macht, und einer Disziplinierung, die spezifische Machtwirkungen über die Kinder entfaltet, und frage, wie zwischen Konformität und Abweichung der (Selbst-)Führung von Körpern unterschieden wird, und wie diese Spaltung Lernen ermöglich/verhindert und mit Herrschaftsverhältnissen verwoben ist (Khakpour 2023; Steinbach u.a. 2020). Autoritäre Erziehung und Disziplinierung war gestern!? Substitutionen erzieherischer Autorisierungen und ihre Folgen für die Profession 1Universität Koblenz, Deutschland; 2Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Österreich Über viele Jahrzehnte gültige und gängige ‘Erziehungsmittel’, wie Disziplinierung, Strafen, autoritäre Erziehung, Einfordern von Unterwerfung und Gehorsam lassen sich heute kaum noch (pädagogisch) legitimieren. Sie gelten als unpädagogisch und sind negativ konnotiert – teilweise werden sie mittlerweile auch staatlich sanktioniert, wie z.B. körperliche Züchtigungen. Zugleich werden aber die Zustände Disziplin und anerkannte Autorität zumeist als erstrebenswerte und wichtige Zustände erachtet. Sie werden als Voraussetzungen pädagogischen Handelns eingefordert und positiv bewertet. Daraus folgt – so der Ausgangspunkt unserer Studie – eine eingeschränkte pädagogische Autorisierung: Ein pädagogischer Zustand soll sein, aber die traditionellen Wege dorthin gelten als illegitim. Pädagog:innen sind nur noch bedingt legitimiert, herzustellen, was als Bedingung der Möglichkeit ihres Handelns gilt. Diese Leerstelle der Autorisierung erzieherischen Handelns untersuchten wir im Rahmen einer diskursanalytischen Studie. Hierfür analysierten wir Erziehungsratgeber entlang folgender Fragen: Wie wird die mangelnde erzieherische Autorisierung mittels verschiedenster Programme, Ansätze und Maßnahmen substituiert? Welche übergeordneten Strategien der (erzieherischen) Autorisierung lassen sich darin ausmachen? Welche Effekte haben die ‚neuen Autorisierungsstrategien‘ der Erreichung von Disziplin und Autorität für die Profession? Der Vortrag präsentiert die zentralen Ergebnisse der Studie. |
| 11:00 - 13:00 | Session Einzelbeiträge IV Ort: HEL 167 Chair der Sitzung: Marina Dangelat |
|
|
„Die Kinder sind nicht ein König oder eine Königin“. Die Positionierung von Erwartungen und Zuständigkeiten am Elternabend. PH Zürich, Schweiz Diverse gesetzlichen Festschreibungen (Bundesrepublik Deutschland, § 6,7, 2022; BV, § 302, 2024) verpflichten Eltern und Lehrer:innen zur Verantwortungsübernahme für die eigenen bzw. qua Auftrag zugewiesenen Kinder und deren Erziehung. «Was diese Verantwortung aber […] genau bedeutet, ist theoretisch – aber natürlich oft auch praktisch – hoch umstritten» (Kuhlmann, 2023, S. 110). Während zwischen Erwachsenen und Kindern ein quasinatürliches intergenerationales Verhältnis zum Ausdruck kommt, ist das intergenerationale Verhältnis zwischen Eltern und Lehrer:in weniger eindeutig definiert. Verantwortlichkeiten zwischen Eltern und Lehrer:innen sind also kontinuierlich auszuhandeln, insbesondere vor dem Hintergrund postulierter Verschiebungen von Grenzen und Zuständigkeiten zwischen Schule und Eltern (Knoll, 2018). Anhand von Daten aus vier Elternabenden, die im Rahmen einer Vorstudie der Längsschnittstudie „Trajektorien im Lehrberuf – Subjektivierung in schulischen Anerkennungsordnungen (TriLSA)“ (vgl. Leonhard, 2025) erhoben und adressierungsanalytisch rekonstruiert wurden (Rose & Ricken 2018, Kuhlmann 2023b), können unterschiedliche Selbst- und Anderenverhältnisse der Lehrer:innen, bpsw. Konzeptionen von Schüler:innen und Eltern als erziehungsfähig bzw. erziehungsbedürftig, sichtbar gemacht werden. In den rekonstruierten Selbstverhältnissen bildet sich auch eine bemerkenswert einheitliche Vorstellung zur generationalen Ordnung ab. Erziehung in der Grundschule aus der Sicht von Lehrpersonen Universität Leipzig, Deutschland Im Rahmen meines Dissertationsprojekts wurden 11 Expert:inneninterviews (Meuser & Nagel 2002) mit Lehrpersonen in Sachsen geführt und mit der Dokumentarischen Methode (Nohl 2017) ausgewertet. Dabei wird der leitenden Forschungsfrage nachgegangen, wie Lehrpersonen über Erziehung in der Grundschule sprechen. Für die Studie wird Erziehung als Zumutung von Handlungsorientierungen aufgefasst, Zumutung im Doppelsinn von Zutrauen und Abverlangen (Nohl 2020). Im Fokus der Auswertung stehen Vorstellungen von Erziehung, beschriebene Zumutungen, deren Durchsetzung und relevante Normen. Im Vortrag wird anhand von zwei kontrastierenden Eckfällen der Studie zum einen gezeigt, welche Identitätsnormen von Lehrpersonen und Schüler:innen und welche Normen der Institution und der institutionellen Programme aufgerufen werden. Zum anderen werden rekonstruierte Orientierungen der Lehrpersonen vorgestellt und in Bezug zu den verschiedenen Normebenen und Vorstellungen von Erziehung gesetzt. Dabei wird u.a. sichtbar, dass einige Lehrpersonen des Samples ein disziplinierendes Verständnis von Erziehung haben, psychologisierend argumentieren und ‚verhaltenstherapeutisch‘ vorgehen. Anknüpfend wird diskutiert, wie das Verhältnis von Disziplinierung und Erziehung in der Grundschule theoretisch beschrieben werden kann, weshalb der Erziehungsbegriff für die Schule relevant bleibt und welche Implikationen sich für die Begriffe der Bildung und Sozialisation im schulischen Kontext ergeben. Erzieherische Erfordernisse aus Sicht von Lehrkräften im Primarbereich in unterschiedlichen Sozialräumen MLU Halle, Deutschland Die Fragestellung die im Beitrag bearbeitet wird ist, welche sozialräumlichen Kontexte Vorstellungen auf erzieherische Tätigkeiten hervorbringen und welche Marginalisierungspotenziale damit einhergehen. Laut KMK (2018) handelt es sich bei Bildung und Erziehung um einen gemeinsamen Auftrag von Eltern und Schule, im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit (vgl. u. a. Textor 2009; Bartscher 2021).Der Beitrag beleuchtet die Wahrnehmung erzieherische Erfordernisse von Seiten der Schule, in unterschiedlichen sozialen und materiellen Kontexten. Sozialraumbezogene Referenzen auf Erziehung werden von Lehrkräften in der Empirie meist in „herausfordernder“ oder „schwieriger Lage“ (Bremm et al 2016) aufgerufen. Das Sample des vorliegenden Beitrags erweitert diese Perspektive um ländliche und kleinstädtische Räume. Im Beitrag wird zunächst in das Projekt und die entsprechenden grundlegenden Begriffe und Fragestellungen eingeführt. Im anschließenden empirischen Teil, werden zwei sozialräumlich kontrastive Fälle vorgestellt, die den Umgang von Lehrkräften mit als defizitär wahrgenommenen Eltern und demzufolge auch den Schüler*innen, als erzieherisches Erfordernis ausdeuten. Darin zeigt sich auf impliziter Ebene eine Orientierung auf Erziehung, die sich abhängig vom materiellen und sozialen Kontext konstituiert, als Ergebnis der Analyse. Basis dafür bilden Gruppendiskussionen mit Lehrkräften die mittels Dokumentarischer Methode (Bohnsack 2017) ausgewertet wurden. |
| 13:00 - 14:00 | Mittagspause |
| 14:00 - 16:00 | Session Einzelbeiträge V Ort: HEL 161 Chair der Sitzung: Anja Gibson |
|
|
Von schulischer Erziehung als Sozialistionskrise (und neuen Anlässen hierzu) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland Schule erzieht Kinder als Monopolinstitut (Elias 1980) einer gegebenen Gesellschaft in und durch ihre Gestalt und Formsprache mittels ihrer spezifischen „Instituethik“ (Bernfeld 2017) und besorgt in strukturfunktionaler Perspektive also die Veröffentlichung von „Neuankömmlingen“ (Arendt 1994) in die sie ermöglichende, gesellschaftliche Sozialität. Es stellt sich die Frage, wie sich die auf eine immer schon vorhandene, alte Gesellschaft und ihre Verfasstheit zielende und aus dieser resultierende, (schul)pädagogische Situation empirisch angesichts eines Wandels der zugehörigen gesellschaftlichen Realität darstellt? Der Beitrag will dieser Relation einer theoretisch stabilen Erziehungsfunktion von Schule und ihrem empirischen Wandel rekonstruktiv-kasuistisch nachspüren. Es soll hierfür das Konzept der „Formmigration“ (Leschke 2008) hinsichtlich interdependenter Isomorphieprozesse von gesellschaftlicher und schulischer Realität empirisch gewendet und die These formuliert werden, dass Erziehung sich als Praxis fassen lässt, die dort anzutreffen ist, wo Sozialisation und die hierin mitlaufende Selbstverständlichkeit eines kooperativen Aufrechterhaltens sozialer Ordnung in die Krise gerät. Transformieren sich Anlässe des Erziehens, produziert dies im Sinne eines "kommunikative[n] Funktionieren[s]“ (Leschke 2008) durchaus Anschlussfähigkeiten an transformierte erziehungssystemische Umwelten, verändern damit aber nicht auch das, was die Schule pädagogisch besorgt, gleich mit. Zur möglichen Verhältnisbestimmung von Erziehung, Sozialisation und Disziplinierung in der Schule als Grundlage empirischer Forschung 1Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland; 2Universität Erfurt Der Vortrag bezieht sich auf den 2. Fragekomplex aus dem CfP. Der Vortrag fragt nach Demarkationslinien der Begriffe Erziehung, Sozialisation und Disziplinierung. Betrachtet man die Begriffsdefinitionen von Erziehung, Sozialisation und Disziplinierung in einschlägigen Grundlagenwerken (Dörpinghaus/Poenitsch/Wigger (2013), Dörpinghaus/Uphoff (2013), Koller (2021), Budde/Rademacher (2023), Hummrich/Kramer (2017)) so fällt auf, dass die Begriffe subtil voneinander abgegrenzt werden. Wird hingegen genauer in den Bereich der praktischen Erziehung in der Schule geschaut, verwischen die Grenzen zusehends. Der Vortrag möchte verschiedene Begriffe von Erziehung über Sozialisation bis hin zu Disziplinierung gegenüberstellen und figurieren. Dabei fällt auf, dass insbesondere der erziehungstheoretische Bezugspunkt weitgehend unklar bleibt, sodass nur schwerlich zwischen Normen- und Werteorientierung Erziehungsambitionen unterschieden wird. Der Vortrag will hier für Klarheit sorgen, um praktische schulische Erziehungsprozesse für die qualitative empirische Forschung klarer abgrenzbar zu machen. Die Schule im Spiegel der Öffentlichkeit. Rekonstruktion öffentlicher Erziehungsvorstellungen (2022–2025). Universität Stuttgart, Deutschland In diesem Beitrag wird Schule als gesellschaftliche Konstruktion (Plake 2010; Budde 2019) verstanden, deren Erziehungsauftrag durch Öffentlichkeiten (Schmidt 2024) geprägt wird. Verfolgt wird die Hypothese, dass auflagenstarke Printmedien wie Bild, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Handelsblatt und Welt (Statista 2024) eigene Vorstellungen von Schule und Erziehung entwickeln, die teils von erziehungswissenschaftlichen Diskursen abweichen, jedoch aufgrund ihrer Reichweite gesellschaftliche Erwartungen beeinflussen. Mittels einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse (Keller 2011) von Zeitungsartikeln (2022–2025) wird rekonstruiert, wie diese Öffentlichkeit Erziehungsaufträge der Schule definiert. Im anvisierten Untersuchungszeitraum rücken Debatten über Digitalität, Künstliche Intelligenz und Inklusion sowie verschärfte politische und wirtschaftliche Lagen in den Fokus, woraufhin (neue) Ansprüche und Erwartungen an Erziehung in und durch Schule formuliert werden. Der Beitrag fragt also, wie Schule und Erziehung in der Öffentlichkeit konstruiert werden. Dabei wird 1. die normativ-gesellschaftliche Dimension der Zuschreibungen an die Schule analysiert und 2. die Frage aufgeworfen, welche impliziten Erziehungskonzepte in medialen Darstellungen dominieren. Ableiten – aus diesen nicht immer pädagogisch informierten Erziehungs- und Schulverständnissen – lassen sich Implikationen für die Schulforschung, um von dort aus (eventuell) zu einer pädagogischen Theorie der Schule (Reichenbach 2017) zu kommen. |
| 14:00 - 16:00 | Session Einzelbeiräge VI Ort: HEL 166 Chair der Sitzung: Alexandra Kollmeier |
|
|
Achtsamkeit in der Schule als kompensatorische Erziehung im Verborgenen? Leibniz Universität Hannover, Deutschland Achtsamkeit hat Hochkonjunktur. Für den schulischen Kontext hat sich ein Markt an Ausbildungsinstituten und Sachliteratur herausgebildet, der neben Dimensionen sozial-emotionalen Lernens (Valtl 2021), z.B. Empathiefähigkeit (José 2016), Beziehungsgestaltung (Jensen 2014) und -fähigkeit (Kaltwasser 2016) sowie Persönlichkeitsentwicklung (Altner/Friedrich 2024) bearbeitet. Der annoncierte Beitrag möchte den Wirksamkeit und Effektivität reklamierenden Bezugspunkt schulischer Achtsamkeitsprogramme den Begründungen (der Notwendigkeit) ihrer Implementation gegenüberstellen. Nimmt man eine sinnverstehende Perspektive ein, zeichnen Programme zur Achtsamkeit in der Schule sich zum einen durch eine „Entfremdungskritik“ (Dietrich/Uhlendorf 2019: 20) aus, zum anderen identifizieren sie in besonderer Weise „Probleme der Familienerziehung“ (a.a.O.: 21; Kollmer 2024). Diese gelten als Referenzpunkt des Beitrags. In einem ersten Schritt soll die Differenz des Anspruchs von Achtsamkeit in der Schule mit ihrem eingelagerten Kulturpessimismus konfrontiert werden. Ein zweiter Schritt fokussiert die Zuschreibung familialer Erziehungsinkompetenz, die sich nicht nur in der Diagnose einer „Erziehungsmisere“ (Kaufmann 2011: 14), sondern auch subtiler Ausdruck verschafft. In einem dritten Schritt wird dargelegt, wie Achtsamkeit in der Schule (latent) postuliert, damit einhergehende Erziehungsdefizite auszugleichen und so fraglich gewordene Normalitätsentwürfe durchzusetzen versucht. Entgrenzte Erziehung?! Schulische Sexualerziehung und das Problem des Pluralisierungsparadoxon Universität zu Köln, Deutschland Skizziert wird zunächst, dass schulische Sexualerziehung wie keine andere Unterrichtsreihe einen „Kampfplatz“ (Benkel/Lewandowski 2021) markiert, anhand dessen grundlegende gesellschaftliche Aushandlungen über Erziehung und die Grenzen der Schule als erzieherische Institution stattfinden (Akbaba/Jeffrey 2017; Bialystok et al. 2020). Innerhalb dieses explizit erzieherischen Unterrichts lassen sich zusätzlich generational und sozialkulturell unterschiedliche Werteprojektionen feststellen (Siemoneit/Kleinau/Verlinden 2022). Daran angeschlossen wird der Diskurs im Kontext des strukturtheoretisch gelesenen Pluralisierungsparadoxons (Helsper 2020; Wernet 2003; Ladenthin 2008) sowie Ruckers Überlegungen zur Rechtfertigungsproblematik erziehenden Unterrichts (Rucker 2019). Mit einer analytischen Wendung dieser Überlegungen zeigen sich zwei Grundprobleme einer Erziehung durch das Unterrichten: 1) gesellschaftlich widersprüchliche Aufforderungen und Grenzsetzungen im Verhältnis von institutionell-öffentlicher und privater Erziehung; 2) das Problem der professionsbezogenen Intention schulischer Erziehung vor dem Hintergrund eines ‚Unterrichtsziels‘. Entnommen einem abgeschlossenen Forschungsprojekt (Hoffmann i.E.; Hoffmann/Proske 2017) konkretisieren abschließend empirisch gewonnene Deutungsmuster, wie Lehrer:innen bezogen auf Sexualität das Pluralisierungsparadoxon als ein Sujet professioneller Erziehungsarbeit in Schule und Unterricht bearbeiten. Pädagogisch-therapeutische Programme und schulische Erziehung. Das Beispiel ETEP Uni Gießen, Deutschland Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik (ETEP) versteht sich als pädagogisch-therapeutisches Interventionsprogramm, das „Lehrkräfte und Pädagog/innen aus anderen Feldern für eine professionelle Erziehungsarbeit“ (ETEP Europe) schulen will. Das Programm präsentiert sich als theoretisch fundiert, effektiv und evidenzbasiert. Zentrale Aspekt des Programms sind das Entwicklungs- und Fördermodell und der entwicklungspädagogische Unterricht. ETEP bietet so aus einer Hand alles für die schulische Erziehung von vor allem „schwierigen“ Schüler:innen – also jenen, die einer „besonderen“, „intensiveren“ oder „kompensierenden“ Erziehung bedürfen (Förderbedarf emotional-soziale Entwicklung) – und wird u.a. vom Hessischen Kultusministerium prominent als Fortbildung gefördert. Viele Schulen (nicht nur in Hessen) bieten auf ihren Webauftritten Informationen zu ETEP. Aufgrund der praktischen Relevanz des Programms bei gleichzeitigt fehlender Präsenz im erziehungswissenschaftlichen Diskurs haben wir uns ETEP genauer angesehen und möchten einerseits die dieser „professionellen Erziehungsarbeit“ zugrundliegenden Begriffe der Entwicklung und Erziehung(sziele) genauer beleuchten, um sodann zu fragen, ob der Erfolg von ETEP auf eine vermeintliche Leerstelle schulischer Erziehung zurückzuführen ist und wie diese mithilfe des Programms gegebenenfalls bearbeitet werden soll. Schließlich soll das Programm einer erziehungswissenschaftlich fundierten kritischen Würdigung/ Kritik unterzogen werden. |
| 14:00 - 16:00 | Session Einzelbeiträge VII Ort: HEL 167 Chair der Sitzung: Lars Wicke |
|
|
Bedeutung und Bedeutsamkeit klären – Zum Konzept werterziehenden Unterrichts Universität Erfurt, Deutschland Dieser Einzelvortrag schließt an den 3. Fragekomplex des CfP an. Bereits von Herbart (1965) wird zwischen schulischer Erziehung (erziehender Unterricht) und eigentlicher Erziehung (Zucht) unterschieden. Begründet wird diese Differenz damit, dass der Unterricht sachliche Lerngegenstände bzw. „etwas Drittes“ betreffe (ebd., 124), während eigentliche Erziehung ausschließlich den Willen der Heranwachsenden fokussiere. Im Anschluss an Herbart könnte man dies auch als einen didaktischen Hiatus zwischen unterrichtlicher „Objektivität“ und erzieherischer „Subjektivität“ (ebd., 125) deuten. Das Konzept eines „werterziehenden Unterrichts“, wie ihn Pöppel (1983), Rekus (1993), Ladenthin (2008) und zuletzt Mikhail (2022) entwickelt haben, versucht, diese Kluft mit der Differenzierung von Bedeutung und Bedeutsamkeit der Lerngegenstände zu überbrücken und soll im geplanten Vortrag als Lösungsvorschlag präsentiert werden. Im Unterricht werden ‚objektive‘ Lerninhalte immer auch zu Gegenständen der subjektiven Bewertung, sodass sowohl die Fachlichkeit des Unterrichts gewahrt als auch die Werthaftigkeit des Gelernten geklärt werden können. Vorteile der Konzeption sind, dass Erziehung in jedem Fachunterricht ermöglicht, ins Setting Schule durch ein Formalstufenmodell implementiert sowie den Konstitutionsbedingungen demokratischer (Wissens-)Gesellschaften entsprochen werden kann. „Es geht jetzt um uns, das Thema ist ‘wertschätzende Lernsprache’." Ethnographische Analysen pädagogischen Erziehungshandelns Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Schweiz Erziehung, so schreibt Bernfeld (1973), sei die Reaktion der Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache, geprägt von deren ökonomisch-sozialer Struktur, und daher stets konservativ – keine Vorbereitung auf Strukturänderung. Erziehungshandlungen spiegeln gesellschaftliche Strukturen wider. Bourdieus rationale Pädagogik (Bourdieu & Passeron, 1971; Rieger-Ladich, 2016) zeigt Erziehung als machttheoretische Auseinandersetzung, die Kräfteverflechtungen aufdeckt. Für Bernfeld (1973) sind Erziehungshandlungen „konstante Reaktionen“, entspringend aus Aggressionsaffekten oder Liebe. Aggressionsaffekte, in der Praxis als Sanktionen sichtbar, sind heute de-thematisiert, was empirische Fragen zur Schulpraxis aufwirft. Vor diesem Hintergrund analysieren wir ethnographische Protokolle aus einer Schweizer Grundschule, um Phänomene der schulischen Praxis als „Erziehungsphänomene“ zu identifizieren. Wir vergleichen Beobachtungsprotokolle aus einer Fortbildung zu wertschätzender Beurteilung mit solchen aus der Praxis. Wir zeigen, wie in der Fokussierung auf „wertschätzende Lernsprache“ moralisch aufgeladene Ansprüche sichtbar werden, die im Erziehungshandeln oft scheitern. Statt bei den Erziehenden wird bei Schüler:innen angesetzt, erzieherische Massnahmen als Bildungsziele gerahmt. Wir skizzieren, wie sich „schulische Erziehung“ beschreiben lässt und wie das Verhältnis solcher Phänomene zur Bildung gedacht werden kann: Wohin wird erzogen? Welche gesellschaftlichen Strukturen zeigt diese Praxis? „Erziehung als bewusster Entzug von Unterstützung und Zumutung von Selbstständigkeit“ Universität Leipzig, Deutschland Der Vortrag nimmt Ausgangspunkt in der Frage wie unterrichtliche Erziehungspraktiken gestaltet sind. Erziehung wird in Anschluss an Budde und Hellberg (2023) verstanden als „normbezogen[e] Subjektivierungsprozesse […] mit dem Ziel der Verhaltensmodifikation“ (ebd., S. 353), sowie einer dauerhaften Einwilligung der Zu-Erziehenden in diese Zumutung (vgl. Nohl, 2022). Die Verhaltensmodifikation (Reichenbach, 2011) soll nicht als Unterbrechung des Unterrichtsflusses zur Thematisierung von Fehlverhalten, sondern ausgehend von der didaktischen Gestaltung des Unterrichts (z.B. das Stellen von Aufgaben) theoretisiert werden (Budde & Hellberg, 2023; Budde & Rademacher, 2023; Schmidt & Herfter, 2019). An einem empirischen Beispiel aus einem Projekt, in dem Lehrkräfte gemeinsam mit Forscher:innen dialogisch ihre unterrichtliche Praxis anhand selbstgewählter Herausforderungen entwickeln (Herfter et al., i.V.), wird gezeigt, wie die Selbsttätigkeit der Schüler:innen im Geschichtsunterricht durch spezifische didaktische Arrangements und eine bewusste Rationalisierung der lehrerseitigen Unterstützung erzieherisch herausgefordert wird. Deutlich wird hierbei aber auch, wie angesichts der sichtbaren Disziplinierung der Schüler:innen die Lehrperson in einen Prozess der Neufindung ihrer unterrichtlichen Positionierung und damit einer Selbsterziehung eintritt (Reichenbach, 2018). |
| 16:00 - 17:30 | Mitgliederversammlung Ort: HEL 160 |
| 18:00 - 23:59 | Gesellschaftsabend Ort: Foyer |
| Datum: Freitag, 12.09.2025 | |
| 9:30 - 10:00 | Ankommen |
| 10:00 - 12:00 | Arbeitsgruppe III Ort: HEL 161 |
|
|
Erziehung durch Hausaufgaben und Widerstand Hausaufgaben sind in eine schulisch initiierte, aber in außerunterrichtliche Räume und Zeiten hineinreichende (Krinninger & Müller, 2020) Praxis eingebettet, in die neben den Schüler:innen und Lehrer:innen oft auch Eltern, andere Familienangehörige oder auch Nachhilfelehrer:innen einbezogen sind. Programmatisch wird – außer von einer didaktischen – von einer erzieherischen Funktion von Hausaufgaben ausgegangen (Kohler, 2017; Standop, 2013): Sie sollen zur Selbstständigkeit, zur Verantwortungsübernahme und zu einer konstruktiven Lern- und Arbeitshaltung erziehen (ebd., S. 51). Die beteiligten Erwachsenen sollen in einer „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ von Schule und Elternhaus diese erziehenden Aufgaben übernehmen oder wenigstens unterstützen. Aus praxistheoretischer Perspektive wird jenseits solcher Programmatiken nach Praktiken rund um Hausaufgaben gefragt (Fuhrmann, 2022; Nieswandt, 2014). Wir konzentrieren uns in diesem Symposium auf hausaufgabenbezogene Praktiken des Erziehens sowie des Wider-stands gegen und des Ausweichens vor Erziehungsan- und -zumutungen. Diese Praktiken wer-den im Sinne der Ethnomethodologie als Problem‘lösungen‘ praktischer Probleme verstanden, deren Ausprägungen und Bearbeitungen wir in drei Vorträgen herausarbeiten. Wir spüren außerdem der Frage nach, inwiefern und in welcher Art Erziehung im Kontext von Hausaufgaben zu beobachten ist, welche Positionen Lehrer:innen, Eltern und Nachhilfelehrer:innen einer-seits und die Schüler:innen/ Jugendlichen andererseits einnehmen und welche ‚Nebenwirkungen‘ die Praktiken haben. Übergreifend sollen Erziehungspraktiken rund um Hausaufgaben als Praktiken der Verschränkung von schulischer und familialer Erziehung diskutiert werden. Theresa Klene: „Gelingen“ und „Scheitern“ von Erziehung aus praxistheoretischer Perspektive Hausaufgaben tragen schulische Belange in die familiale Ordnung hinein (Krinninger & Müller 2020, S. 173). So können sie nicht nur eine vom Ort Schule entkoppelte erzieherische Wirkung entfalten, sondern verschränken zugleich schulische und familiale Erziehungspraktiken miteinander. Dies soll anhand zweier kontrastierender Fälle beleuchtet werden. Während im ersten Fall familiale Interaktionen zwischen Mutter und Schüler:in beim gemeinsamen Hausaufgabenmachen beschrieben werden – sich der Schullogik folgend also ein vermeintliches Gelingen zeigt –, stellt der zweite Fall das Verbleiben der Hausaufgaben in der Schule dar und verweist auf ein mögliches erzieherisches Scheitern. Durch die praxistheoretische Perspektive rücken nicht nur die erzieherischen Intentionen pädagogischer Programmatiken in den Blick, sondern auch die unerwarteten und ungewünschten Effekte von Erziehung, die in ihrer Vielfalt von Unterlaufen, Koexistenz, Umkehrung bis zum Scheitern reichen können (Budde, 2020). Valentin Bähr: Häusliche Nachhilfe zwischen schulischer und familialer Erziehung Die Normen und Prinzipien einer schulischen Erziehung können über die lokale Begrenzung der Schule hinaus wirken, was wir durch eine multi-sited Ethnography (Marcus, 1995) untersuchen. Dabei zeigt sich, wie in der häuslichen Nachhilfe innerhalb einer sozioökonomisch prekär positionierten Familie die familiale und schulische Dimension von Erziehung eng verflochten und gleichzeitig kontrastierend zueinander aufgestellt sind: So findet sie etwa im familialen Raum statt, bearbeitet aber familiale und schulische Anforderungen. Nachhilfekräfte sind weder ganz (schulische) Lehrperson noch Familienmitglied, gleichzeitig zeigen sich deutliche Aspekte von beiden Positionen. Zentral für den Beitrag ist die praxistheoretisch perspektivierte Frage, wie über die Nachhilfelehrerin (schulförmige) Erziehung beobachtbar (Budde, 2021) in das Feld der Familie gelangt, und wie sie dort wiederum von den verschiedenen familialen Akteur:innen sinngenerierend bearbeitet wird. Nora Katenbrink: Abschreiben als Widerstand gegen oder als Resultat von Erziehung? Das Abschreiben von Hausaufgaben kann als Widerstand gegen die erzieherischen Intentionen gedeutet werden. Die Ergebnisse einer Interviewstudie mit Schüler:innen (8. bis 13. Jahrgang unterschiedlicher Schulformen) zeigen, dass diese sich für Freizeitaktivitäten, Entspannung und Nichtstun entscheiden und durch das Abschreiben mögliche negative Sanktionen umgehen. Insbesondere rigide und sanktionsreiche Kontrollpraktiken von Lehrkräften führen eher zu vermehrtem Abschreiben als zur intensiven Bearbeitung der Hausaufgaben (Katenbrink & Kohler, 2024). Damit kann das Abschreiben auch als Resultat von Erziehung gesehen werden. Im Rahmen des Vortrags soll daher reflektiert werden, inwiefern Praktiken des Abschreibens von Schüler:innen die unmittelbare Verhaltenskontrolle durch Hausaufgaben und damit ein mögliches erzieherisches Anliegen des Unterrichts sowie den mehrdeutigen und diffusen Charakter von Hausaufgaben als Lern-, Erziehungs- und Selektionsanlass (Wernet, 2023) bearbeiten. Beiträge des Symposiums „Gelingen“ und „Scheitern“ von Erziehung aus praxistheoretischer Perspektive Häusliche Nachhilfe zwischen schulischer und familialer Erziehung Abschreiben als Widerstand gegen oder als Resultat von Erziehung? |
| 10:00 - 12:00 | Arbeitsgruppe IV Ort: HEL 166 |
|
|
‚Demokratie-Erziehung‘ in und durch Schule Die Arbeitsgruppe reflektiert das Verhältnis von Demokratie und Erziehung mit Fokus auf Lehrer*innen. Diese werden hinsichtlich des Verhältnisses verschiedentlich positioniert: Sie sind Erzieher*innen, die in schulischen Interaktionsprozessen demokratische Werte an Schüler*innen vermitteln sollen, sie kommen als politische Akteur*innen ins Spiel, die Demokratie in Erziehungsprozessen praktizieren und sie können als Adressierte von Demokratieerziehung in den Blick geraten (etwa in Fortbildungen). Lehrer*innen agieren als Mitglieder der Organisation Schule, die für die strukturierte Weitergabe gesellschaftlicher Tradierungsbestände an die jüngere Generation – u.a. qua Erziehung – eine bedeutsame Stellung einnimmt. Teilweise vollzieht sich die schulische Weitergabe ambivalent. Während in Schule einerseits Demokratieerziehung praktiziert wird, indem u.a. ein produktiver Umgang mit Differenz eingeübt wird, werden gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse andererseits reproduziert (z. B. Gomolla & Radtke 2009). Gleichheit und Differenz erweisen sich in der Schule und in schulischen Formen von ‚Demokratie-Erziehung‘ als spannungsvoll aufeinander bezogen. Die damit verbundenen Relationierungen werden in der Arbeitsgruppe aufgegriffen und dabei Überlegungen aus Schultheorie, Erwachsenenerziehung und schulischer Demokratieerziehung miteinander verknüpft. Wie stehen Erziehung und Sozialisation im Kontext schulischer Demokratiepädagogik zueinander im Verhältnis bzw. welche Spannungen zeigen sich? Welche Ambivalenzen resultieren aus einer Responsibilisierung von Lehrer*innen für Demokratieerziehung? Wie wird Erziehung in und durch Schule in antidiskriminierungsbezogenen Lehrer*innenfortbildungen konzipiert? Diesen und weiteren Fragen und Spannungen gehen wir in drei Beiträgen der Arbeitsgruppe sowie in der übergreifenden Diskussion nach. Beitrag 1: Der Verweis auf Erziehung in/durch Schule aktualisiert die Frage nach dem schulischen Verhältnis von Erziehung und Sozialisation. Der theoretisch ausgerichtete Beitrag nimmt eine Systematisierung dieses Verhältnisses im Hinblick auf eine schulische Demokratiepädagogik vor. Er erörtert dementsprechend Möglichkeiten und Grenzen eines schulischen „democracy buildings“ im Spannungsfeld von Erziehung und Sozialisation: So gilt die Integration von Schüler*innen in eine demokratisch verfasste Gesellschaft qua Leistungsdifferenzierung einerseits als eine der zentralen sozialisatorischen Leistungen der Schule (Dreeben 1980). Gleichzeitig setzen zahlreiche Schulkritiken an den Nebeneffekten einer solchen Erziehung durch Schule an (Zinnecker 1975), denen dann Konzepte einer partizipativen Demokratieerziehung in Schule entgegengesetzt werden (Heinzel & Geiling 2004). Auch diese können sich den sozialisatorischen Nebeneffekten einer Verschulung von Demokratisierungsprozessen jedoch kaum entziehen. Beitrag 2: Angesichts sinkender Zustimmung zur bestehenden Demokratie bei zugleich wachsender Unterstützung demokratiefeindlicher Positionen (Decker et al. 2024) werden im gesellschaftlich polarisierten Klima verstärkt Rufe nach einer Stärkung von Demokratieerziehung an Schule laut, die dort flächendeckend als fächerübergreifende Querschnittsaufgabe verankert ist (u.a. KMK 2018; Dempki & Josting 2021). Im Namen der Verteidigung der Demokratie erfolgen ‚erzieherische‘ Zugriffe auf Schule und ihre Lehrkräfte, die Haltung zeigen, sich positionieren und als ‚Agenten der Demokratie‘ Verantwortung übernehmen sollen (u.a. Berkemeyer et al. 2023; SWK 2024). Der Vortrag untersucht diskursanalytisch, wie diese Adressierungen in bildungspolitischen Dokumenten erfolgen (Ricken et al. 2017) und reflektiert die Ergebnisse vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung zunehmender rechtspopulistischer Einflussnahmen (Hempel & Kiess 2023) sowie struktureller Widersprüche von Demokratieerziehung als fächerübergreifender Querschnittsaufgabe. Beitrag 3: Im Vortrag möchten wir die – vor allem begriffstheoretisch geführten – Kontroversen um eine Erwachsenen-Erziehung (vgl. z.B. Holzer 2022) empirisch wenden. Wir nehmen dafür Lehrkräftefortbildungen zu schulischer Antidiskriminierung in den Blick, die als Element von Demokratiepädagogik verstanden werden. Die Fortbildungen zielen darauf, Handlungsorientierungen von Lehrpersonen zu verändern (vgl. Nohl 2023) und können damit ihrem Anspruch nach als erzieherisch verstanden werden. Anhand rekonstruktiver Analysen ethnographischer Daten möchten wir denjenigen Praktiken in den Fortbildungen nachgehen, die sich als erzieherisch zeigen. Wir fragen danach, wie diese Praktiken als Erziehung relevant werden und wie sie ihre Bedeutung als eine solche de-thematisieren. Unter der Annahme, dass die Fortbildungen – und die in sie eingelagerten Erziehungszumutungen – mit dem Ziel konzipiert sind, auch die schulische Praxis von Lehrkräften selbst zu verändern, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Erziehung durch Fortbildungen und der Erziehung in der Schule. Beiträge des Symposiums Zur Aktualisierung des Verhältnisses von Erziehung und Sozialisation im Kontext schulischer Demokratiepädagogik Demokratieerziehung unter Druck: Adressierungen von Schule und Lehrkräften in polarisierten Zeiten Demokratiepädagogische Erziehung von Lehrer*innen für die Erziehung von Schüler*innen |
| 10:00 - 12:00 | Arbeitsgruppe V Ort: HEL 167 |
|
|
Diskutieren als Erziehung!? Diskursive Formen im Fachunterricht als schulischer Erziehungsbeitrag In einigen Schulfächern wie Deutsch, Politik oder Philosophie, in denen die Gegenstände nicht eindeutig in richtig/falsch unterschieden werden können, sondern diese mehrere Meinungen bzw. Interpretationen zulassen, wurden fachdidaktische Konzepte entwickelt, die diskursive Auseinandersetzung unter den Schüler*innen zu einer zentralen Form erheben (vgl. z.B. Steinbrenner/Wiprächtiger-Geppert 2006; May-Krämer 2019, Drerup/Yacek 2020). In diesen Ansätzen wird durchweg der Anspruch formuliert, dass durch diskursive Gesprächsformen nicht nur Inhalte wie auch zentrale Fachkompetenzen vermittelt werden sollen, sondern dass dem Diskutieren selbst auch ein pädagogischer Wert zukomme. Folglich geht es den diskursiven Formen bzw. beim Diskutieren in diesen Fächern sowohl um Erziehung zum Diskutieren als auch um Erziehung durch das Diskutieren. Der erziehungstheoretische Diskurs hat diese diskursiven Praxisformen bisher jedoch nicht systematisch reflektiert. In deutschsprachigen Handbücher finden sich ausschließlich allgemeinere Praktiken des Erziehens wie das klassenöffentliche Gespräch, das auch sehr lehrkraftgesteuerte Formen umfasst (vgl. z.B. Bittner 2012). Dies verwundert umso mehr, als im englischsprachigen Raum in den letzten 40 Jahren eine Auseinandersetzung um verschiedene Formen diskursiven Unterrichts, der die Partizipation der Schüler*innen ins Zentrum des Unterrichts stellt, unter Begriffen wie ‚dialogic/discoursive teaching‘ systematisch entwickelt wurde (vgl. Nystrand 1997, Wells/Arauz 2006, Boyd 2015). Dieser Umstand könnte u.a. auf die recht weitgehende Beschränkung erziehungswissenschaftlicher Unterrichtsforschung auf die Sozialdimension (z.B. auf Inklusion, Partizipation) und der fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Forschung auf die Sachdimension (z.B. Vermittlung, Fachlichkeit) zurückgeführt werden. Das Symposium bearbeitet dieses Desiderat, indem anhand von drei unterschiedlichen Fächern die empirische Praxis des unterrichtlichen Diskutierens vergleichend qualitativ-rekonstruktiv untersucht wird. Übergreifende Forschungsfragen sind dabei: - Welche gemeinsamen und unterschiedlichen Erziehungspraktiken der diskursiven Aushandlung und zum diskursiven Verhandeln zeigen sich empirisch? - Welche gemeinsamen und unterschiedlichen Erziehungsanforderungen für das Diskutieren werden sichtbar? - An welchen empirischen Erscheinungsformen lässt sich das unterrichtliche Diskutieren sowohl vom allgemeinen Diskutieren als auch von anderen Formen des unterrichtlichen Gesprächs unterscheiden und damit erziehungstheoretisch als Form der Erziehung verstehen? König, Hannes / Lehndorf, Helen Erziehung zum Diskurs? Zur Diskursivität des Literaturunterrichts Ausgangspunkt des Beitrags ist die empirische Beobachtung, dass Diskursivität für den Literaturunterricht zwar normativ und empirisch prägend ist, dass allerdings die allgemeine, fachübergreifende Doktrinalität des schulischen Unterrichts damit nicht grundsätzlich überwunden wird. Vielmehr finden sich sachinduzierte Momente der Diskursivität zum einen, zum anderen Inszenierungen von Diskursivität. Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage soll sequenzanalytisch untersucht werden, ob mit einer so verstandenen Diskursivität des Literaturunterrichts spezifische Erziehungsanforderungen einhergehen, die sich von denen des doktrinalen Unterrichts unterscheiden. Herfter, Christian Urteilsbildung im Geschichtsunterricht Der Beitrag widmet sich der Praxis der Erziehung zur Sach- und Werturteilsbildung im Geschichtsunterricht. Am empirischen Beispiel wird untersucht, wie Lernende historische Ereignisse analysieren, in gemeinsamen Diskussionen Sichtweisen aushandeln und dabei Urteilsbildungsprozesse gestalten. Am empirischen Material wird ein systematisches Auseinanderfallen zwischen didaktischem Anspruch an schülerseitige Urteilsbildungsprozesse und realisierter Praxis sichtbar. Auf Basis von vielfältigen Vorarbeiten zur Theorie des Unterrichts als einer pädagogischen Ordnung wird versucht, diese Differenz zu erklären. Goldmann, Daniel Die Form des Diskutierens erzieht! Am Beispiel des Mathematikunterrichts wird das unterrichtliche Diskutieren als schulische Erziehung reflektiert. Auf Basis systemtheoretischer Unterrichts-, Lern- und Erziehungstheorie wird die These entworfen, dass über diese Form des Diskutierens vorhandene Varianten von Unterricht nicht bloß durch eine weitere ergänzt werden. Vielmehr konstituiert sie eine kategorial andere abduktiv-reflexive Ordnungsbildung, die sich grundlegend vom etablierten Modus linear-technischer Vermittlung in Schule unterscheidet. Über diese Theoretisierung können zum einen bloße Inszenierungen oder ‚Fehlformen‘ von Diskussionen im Unterricht als linear-technische Überformungen der Form des Diskutieren verstanden und damit erklärt werden. Zum anderen wird sichtbar, dass beim Diskutieren nicht die Lehrkraft, sondern die Form selbst zu zentralen Zielen wie Inklusion oder Demokratie erzieht. Beiträge des Symposiums Erziehung zum Diskurs? Zur Diskursivität des Literaturunterrichts Urteilsbildung im Geschichtsunterricht Die Form des Diskutierens erzieht! |
| 12:00 - 12:30 | Kaffeepause |
| 12:30 - 13:00 | Verabschiedung Ort: HEL 160 |